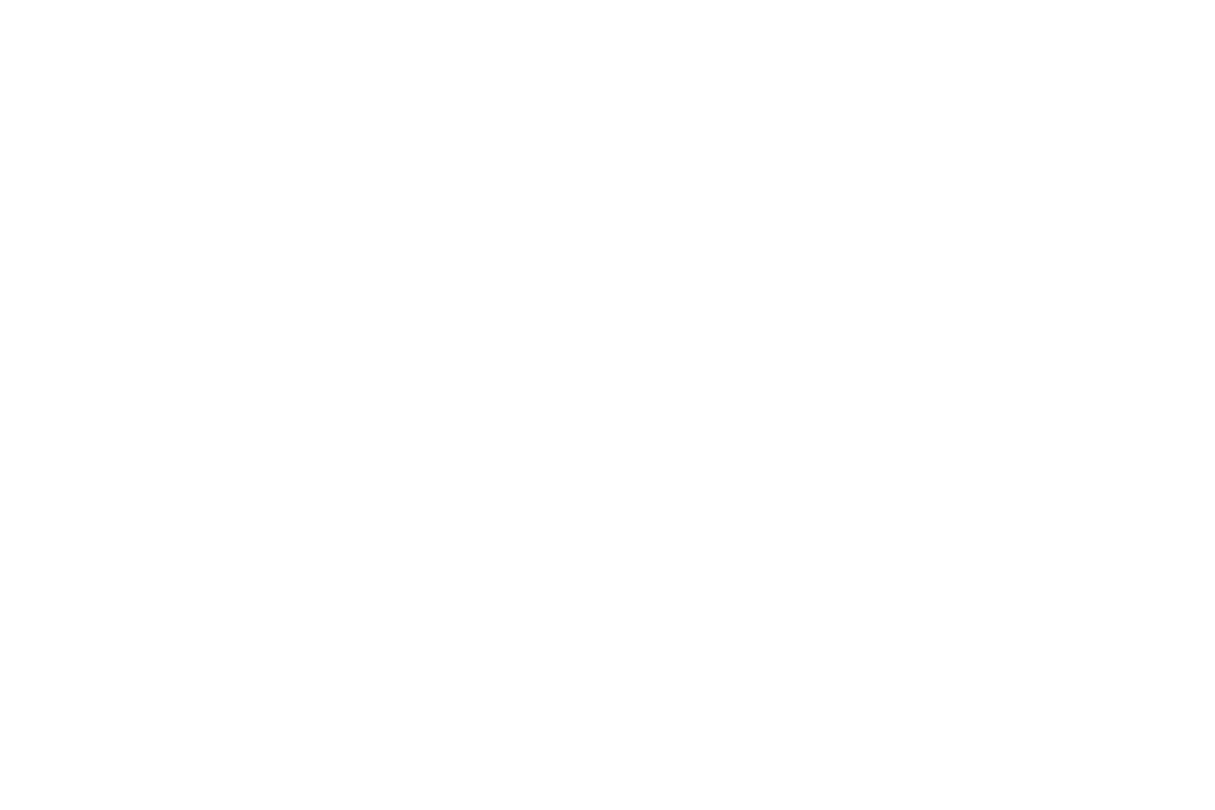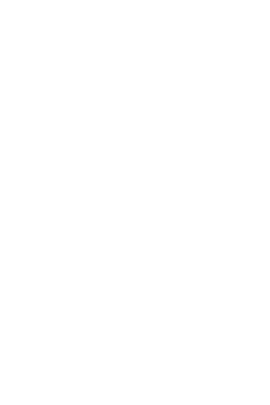Uraufführung 08.04.2011
› Kleines Haus 2
Das halbe Meer
von Thomas Freyer
Handlung
Mitten im Atlantik auf einer Insel, dem am weitesten von aller Zivilisation entfernten Punkt, lebt eine kleine Gruppe von Menschen ein einfaches und scheinbar friedliches Leben. Vor mehr als dreißig Jahren kam der alte Koberitz auf dieser Insel an und ritzte die Grundsätze seiner kleinen Republik in ein Stück Treibholz. Gleichberechtigt sollten alle Bewohner sein, alle Entscheidungen demokratisch getroffen werden und aller Besitz Gemeingut sein. Über die Jahrzehnte sind weitere Siedler hinzugekommen, und inzwischen leben drei Generationen auf dem unwirtlichen Eiland, die Jüngsten von ihnen sind hier geboren und haben nie etwas anderes kennen gelernt als diese Insel.
Doch in letzter Zeit bleiben die Schiffe aus, mit denen sie Handel getrieben haben, und während die Kartoffeln in ihren Speichern zu faulen beginnen, fehlt es ihnen an all den Dingen, die sie nicht selbst erzeugen können. Als eines Tages ein fremder, junger Mann auf der Insel strandet, der sich nicht erinnern kann, wer er ist und woher er kommt, beginnt die Fassade der kleinen Inselwelt rasch zu bröckeln. Das eingespielte System gerät ins Wanken. Die Siedler empfinden den Gestrandeten als Eindringling, die Geldnot und das Ausbleiben des Versorgungsschiffs machen den Verzicht auf Eigentum zunehmend schwerer. Nach und nach brechen die ersten Bewohner mit den Grundsätzen ihres Zusammenlebens, aus Angst übervorteilt zu werden. Thomas Freyers neues Stück beschreibt den Untergang eines Gesellschaftsentwurfs, das Scheitern von Idealen, die Suche nach Identität und Heimat und den Moment des Verharrens zwischen Resignation und Aufbruch.
Doch in letzter Zeit bleiben die Schiffe aus, mit denen sie Handel getrieben haben, und während die Kartoffeln in ihren Speichern zu faulen beginnen, fehlt es ihnen an all den Dingen, die sie nicht selbst erzeugen können. Als eines Tages ein fremder, junger Mann auf der Insel strandet, der sich nicht erinnern kann, wer er ist und woher er kommt, beginnt die Fassade der kleinen Inselwelt rasch zu bröckeln. Das eingespielte System gerät ins Wanken. Die Siedler empfinden den Gestrandeten als Eindringling, die Geldnot und das Ausbleiben des Versorgungsschiffs machen den Verzicht auf Eigentum zunehmend schwerer. Nach und nach brechen die ersten Bewohner mit den Grundsätzen ihres Zusammenlebens, aus Angst übervorteilt zu werden. Thomas Freyers neues Stück beschreibt den Untergang eines Gesellschaftsentwurfs, das Scheitern von Idealen, die Suche nach Identität und Heimat und den Moment des Verharrens zwischen Resignation und Aufbruch.
Besetzung
Regie
Tilmann Köhler
Bühne
Karoly Risz
Kostüme
Susanne Uhl
Musik
Jörg-Martin Wagner
Dramaturgie
Luise Mundhenke
Licht
Hans Koberitz
Die alte Herbert (Brunhilde)
Kranz
Tobel
Fabian Gerhardt
Johanna Schlicht
Antje Trautmann
Mille
Sascha Göpel
Pete, Sohn von Kranz
Christian Clauß
Janne, Tochter von Tobel
Ines Marie Westernströer
Cembalo
Sonnhild Fiebach
Video
Pressestimmen
Dramatiker im Gespräch
Die Dramatiker Thomas Freyer, Martin Heckmanns, Lutz Hübner, Dirk Laucke, Jan Neumann und Ewald Palmetshofer im Gespräch über neue Geschichten, deutsche Beißreflexe und das Publikum im Kopf
In der Spielzeit 2009.2010 gab es am Staatsschauspiel Dresden vier Uraufführungen renommierter Autoren sowie ein Projekt mit Texten von fünf Studierenden des Studiengangs Szenisches Schreiben der Universität der Künste in Berlin zu sehen. Auch weiterhin will das Staatsschauspiel Dresden ein Ort sein, an dem Gegenwartsdramatik eine besondere Bedeutung haben soll. Daher haben wir für die kommende Spielzeit wieder Autoren eingeladen, für uns zu schreiben, in der Hoffnung, aus ihren dramatischen Produktionen etwas Neues zu erfahren über die Gegenwart, aktuelle Konflikte und die Welt, in der wir leben.
Martin Heckmanns: Wie findet ihr eure Themen? Auf der Straße, in der Zeitung, oder gibt es eine besondere Form der Suche?
Jan Neumann: Es ist mir erst einmal passiert, dass ich die Zeitung aufgeschlagen und einen Artikel gelesen habe, bei dem ich heulen musste und sofort wusste, dass ich aus der Geschichte ein Stück machen muss. Das habe ich dann auch zwei Wochen später gemacht. Deshalb lese ich jetzt immer fleißig Zeitung, aber leider stellt sich diese Art der inspirierenden Lektüre nicht regelmäßig ein.
Thomas Freyer: Es geht ja eher um die Impulse, die es für ein Stück braucht, weniger um die Themen. Und die Impulse bekomme ich meistens aus konkreten Begegnungen mit einem Problem, das sich nicht sofort erklären oder lösen lässt und das man in einem Text für sich bearbeiten kann. Ein Thema muss die Lust an der Auseinandersetzung wecken, um zu einem Stück zu werden.
Ewald Palmetshofer: Bei mir ist das ähnlich. Die Annäherung an ein Stück geht am ehesten von einem Problem aus, von einer Frage. Bei „hamlet ist tot. keine schwerkraft“ hat sich das z. B. an der Frage nach der Gegenwart entzündet. Was ist sie? Wie bekommt man sie in den Blick? Wie davon sprechen? Was bedeutet eine Handlung, einen Akt setzen, ein Tun erzwingen? Bei meinem Faust-Stück waren es dann das Glück und der Tod, der plötzlich in meine Nähe gekommen ist. Bei meinem neuen Stück „Man wird doch bitte unterschicht“ geht alles von der Frage aus, was ein Subjekt ist und was das Tier Mensch. Das Schreiben beginnt dort, wo ich diese Fragen ins Extrem treibe und mich das bloße Denken nicht mehr weiterbringt.
Dirk Laucke: Mit meinen Geschichten habe ich immer persönlich etwas zu tun. Ich habe einen Job gehabt, der mich angekotzt hat, und ich frage mich, was die Leute wohl jetzt machen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, und was die für Probleme hatten und jetzt noch haben. Für die Bühne verschärfe ich die Konflikte, und dann ist es meistens schon ein Drama. Ich gucke mir bewusst wenig an und lese auch nichts zu dem jeweiligen Thema, weil es mich wahrscheinlich nur verwirren würde, was es dazu alles schon gibt.
Lutz Hübner: Ich lese auch nur in der Vorbereitung Romane oder Studien zu meinem Thema, um mich anzufüttern, aber wenn ich Dialoge schreibe, kann ich dazu nichts mehr lesen. Es sortiert sich dann meistens gut von selbst aus, was hängen bleibt und was in der Schreibphase noch wichtig ist. Und Theaterstücke lese ich nur, wenn ich höre, dass jemand ein ähnliches Thema schon ähnlich behandelt hat.
Zu den großen Themen gibt es meistens schon andere Stücke.
Hübner: Aber selten mit demselben Zugriff. Und letztlich sind es die Details und die eigenen Vorgehensweisen, die die Themen beim Schreiben interessant machen.
Palmetshofer: Ich bin mir da nicht so sicher, inwieweit es tatsächlich zu den großen Themen immer schon andere Stücke gibt. Vielleicht sind manche Themen auch erst zu einer bestimmten Zeit benennbar oder treten erst als Themen in Erscheinung. Wenn ich vorhin vom Subjekt geredet habe oder vom Glück, dann könnte es ja auch sein, dass das heute, jetzt, etwas anderes meint. Dann wäre vielleicht die thematische Überschrift eine bekannte, aber das, was sich darunter versammelt, ist vielleicht neu.
Neumann: Ich würde auch sagen, dass es in erster Linie nicht um das Was, sondern um das Wie der Geschichten geht. Es gibt diese berühmte Anekdote von Billy Wilder, der in der Nacht aufwacht, um eine geniale Idee für einen neuen Film aufzuschreiben, die er im Traum gehabt hat, und am nächsten Morgen steht da geschrieben: „Boy meets girl“. Das ist für mich ein Beispiel dafür, dass die alten Geschichten neu erzählt werden müssen, gespeist aus der subjektiven Lebenserfahrung des Erzählenden.
Freyer: Eine Reaktion darauf, dass es die meisten Geschichten schon gibt, ist bei vielen Autoren die Ironie – man nimmt nichts mehr ernst. Das erlebe ich oft bei meinen Schreibworkshops, dass sich die Schreiber aus den verschiedenen Schubladen ihre Stücke zusammensuchen, und die einzige Haltung, die dahinter zu entdecken ist, ist Ironie. Die einzige Aussage ist dann, dass diese Generation orientierungslos ist und sich ihr Leben zusammensampelt.
Neumann: Das war für mich eigentlich der Ausgangspunkt, selber zu schreiben, dass ich das Theater der 90er-Jahre viel zu oft als ironisch oder zynisch erlebt habe. Ich habe vermisst, dass Geschichten erzählt werden, die etwas zu tun haben mit dem Menschen, der da unten sitzt, die man ernst nimmt. Das Theater ist für mich einer der letzten werbefreien Räume, die wir haben, und diesen Raum gilt es zu schützen. Und es gibt eine große Sehnsucht, auch des Publikums, nach Geschichten, die mehr sind als eine glatte, abwehrende Oberfläche, nach einem Pfeil mit Widerhaken. Man macht es sich mit dieser zynischen Haltung zu leicht.
Was ist mit zynischem Theater gemeint?
Neumann: Ich fand das in den 90er-Jahren schon sehr stark, gar nicht in erster Linie bei den Autoren, sondern eher in der Art, wie Theater gemacht wurde, dass alles auf Distanz gehalten wurde. Ich habe ja als Schauspieler angefangen und in dieser Zeit sehr oft erlebt, dass ich Regisseure vor mir sitzen hatte, die kein Interesse hatten an einem Text oder an einer Figur, oft nicht einmal an einem Schauspieler, sondern in erster Linie an ihrem gelackten Mercedes vor der Tür.
Hübner: Das war nicht nur eine Regiemarotte, sondern auch eine Tendenz der Kritik, dass Geschichten, die einfach waren oder berühren wollten, fast reflexhaft weggebissen wurden mit der Haltung: Wenn es nicht wehtut, kann es keine Kunst sein. Ich hatte immer das Gefühl, dass da unten im Parkett die abgebrühten SMm-Freier sitzen, die es jetzt härter brauchen. Dann kannst du aber als Autor und auch als Schauspieler eigentlich keine Figuren entwickeln, weil Figuren sich nicht ständig in Extrembereichen bewegen.
Woher kommt dieser Beißreflex?
Hübner: Das scheint mir schon spezifisch deutsch, auch dass Komödien hier extrem schnell weggebissen werden, mit denen die Engländer beispielsweise nicht das geringste Problem haben. Es darf nicht zu komisch sein oder zu berührend, dann ist es populistisch.
Aber ist es nicht auch eine berechtigte Forderung, dass das Theater Grenzen testen soll und auch formal verstörender sein muss als kommerzialisiertes Geschichtenerzählen im Fernsehen? Bietet dieser Ort nicht gerade die Möglichkeit, Formen zu erfinden jenseits von klassischer Dramaturgie und Rollenpsychologie? Muss dieser Freiraum nicht noch viel radikaler genutzt werden? Oder worin besteht der Unterschied zu Film und Fernsehen?
Laucke: Ich habe ein Drehbuch geschrieben, und das Wichtigste an dieser Erfahrung ist die Einsicht, warum die Dinger oft so platt sind: weil da so viele Leute reinquatschen, dass du irgendwann machst, was die dir sagen. Und dass fast ausschließlich über einen möglichst breiten Zuschauerzuspruch nachgedacht wird, bis in die Details der Geschichten hinein.
Hübner: Fernsehen hat eine ganz andere Sprache und es ist eine Industrie, aber ich würde es nicht gegen das Theater ausspielen. Es gibt in beiden Bereichen gelungene Produktionen. Das Besondere der Theatererfahrung ist doch, dass ich 100 oder mehr atmende Menschen neben mir habe und dass das Geschehen auf der Bühne mir näherkommt als auf der Mattscheibe. Das ist der Push, dass es diese Art der gemeinsamen Konzentration gibt. Aber die Verstörung durch einen schockierenden Regieeinfall macht dieses Gemeinsame oft kaputt. Und Verstörung ist nicht per se eine Qualität. Die Härte muss sich aus der Geschichte ergeben und darf kein reiner Geschmacksverstärker sein. Mit diesen Schockeffekten schließt man auch ein bestimmtes Publikum automatisch aus.
Palmetshofer: Ich glaube, im Kern hat der Film einfach kein Sprachproblem, oder anders gesagt: Das Sprechen ist im Film kein Problem oder stellt sich als unproblematisch dar. Im Film dominiert das Bild über das Wort. Und dieses Bild geht mittlerweile bis in die dritte Dimension, in den Hyperrealismus, egal wie imaginär diese Bilder auch sein mögen. Oder wie gebrochen, wenn z. B. versucht wird, Authentizität darzustellen. Für mich ist Theater dem Wort ausgesetzt und dem Problem, dass wir sprechen bzw. sprechen müssen. Das ist auch das, was mich daran interessiert.
Martin Heckmanns: Wie findet ihr eure Themen? Auf der Straße, in der Zeitung, oder gibt es eine besondere Form der Suche?
Jan Neumann: Es ist mir erst einmal passiert, dass ich die Zeitung aufgeschlagen und einen Artikel gelesen habe, bei dem ich heulen musste und sofort wusste, dass ich aus der Geschichte ein Stück machen muss. Das habe ich dann auch zwei Wochen später gemacht. Deshalb lese ich jetzt immer fleißig Zeitung, aber leider stellt sich diese Art der inspirierenden Lektüre nicht regelmäßig ein.
Thomas Freyer: Es geht ja eher um die Impulse, die es für ein Stück braucht, weniger um die Themen. Und die Impulse bekomme ich meistens aus konkreten Begegnungen mit einem Problem, das sich nicht sofort erklären oder lösen lässt und das man in einem Text für sich bearbeiten kann. Ein Thema muss die Lust an der Auseinandersetzung wecken, um zu einem Stück zu werden.
Ewald Palmetshofer: Bei mir ist das ähnlich. Die Annäherung an ein Stück geht am ehesten von einem Problem aus, von einer Frage. Bei „hamlet ist tot. keine schwerkraft“ hat sich das z. B. an der Frage nach der Gegenwart entzündet. Was ist sie? Wie bekommt man sie in den Blick? Wie davon sprechen? Was bedeutet eine Handlung, einen Akt setzen, ein Tun erzwingen? Bei meinem Faust-Stück waren es dann das Glück und der Tod, der plötzlich in meine Nähe gekommen ist. Bei meinem neuen Stück „Man wird doch bitte unterschicht“ geht alles von der Frage aus, was ein Subjekt ist und was das Tier Mensch. Das Schreiben beginnt dort, wo ich diese Fragen ins Extrem treibe und mich das bloße Denken nicht mehr weiterbringt.
Dirk Laucke: Mit meinen Geschichten habe ich immer persönlich etwas zu tun. Ich habe einen Job gehabt, der mich angekotzt hat, und ich frage mich, was die Leute wohl jetzt machen, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, und was die für Probleme hatten und jetzt noch haben. Für die Bühne verschärfe ich die Konflikte, und dann ist es meistens schon ein Drama. Ich gucke mir bewusst wenig an und lese auch nichts zu dem jeweiligen Thema, weil es mich wahrscheinlich nur verwirren würde, was es dazu alles schon gibt.
Lutz Hübner: Ich lese auch nur in der Vorbereitung Romane oder Studien zu meinem Thema, um mich anzufüttern, aber wenn ich Dialoge schreibe, kann ich dazu nichts mehr lesen. Es sortiert sich dann meistens gut von selbst aus, was hängen bleibt und was in der Schreibphase noch wichtig ist. Und Theaterstücke lese ich nur, wenn ich höre, dass jemand ein ähnliches Thema schon ähnlich behandelt hat.
Zu den großen Themen gibt es meistens schon andere Stücke.
Hübner: Aber selten mit demselben Zugriff. Und letztlich sind es die Details und die eigenen Vorgehensweisen, die die Themen beim Schreiben interessant machen.
Palmetshofer: Ich bin mir da nicht so sicher, inwieweit es tatsächlich zu den großen Themen immer schon andere Stücke gibt. Vielleicht sind manche Themen auch erst zu einer bestimmten Zeit benennbar oder treten erst als Themen in Erscheinung. Wenn ich vorhin vom Subjekt geredet habe oder vom Glück, dann könnte es ja auch sein, dass das heute, jetzt, etwas anderes meint. Dann wäre vielleicht die thematische Überschrift eine bekannte, aber das, was sich darunter versammelt, ist vielleicht neu.
Neumann: Ich würde auch sagen, dass es in erster Linie nicht um das Was, sondern um das Wie der Geschichten geht. Es gibt diese berühmte Anekdote von Billy Wilder, der in der Nacht aufwacht, um eine geniale Idee für einen neuen Film aufzuschreiben, die er im Traum gehabt hat, und am nächsten Morgen steht da geschrieben: „Boy meets girl“. Das ist für mich ein Beispiel dafür, dass die alten Geschichten neu erzählt werden müssen, gespeist aus der subjektiven Lebenserfahrung des Erzählenden.
Freyer: Eine Reaktion darauf, dass es die meisten Geschichten schon gibt, ist bei vielen Autoren die Ironie – man nimmt nichts mehr ernst. Das erlebe ich oft bei meinen Schreibworkshops, dass sich die Schreiber aus den verschiedenen Schubladen ihre Stücke zusammensuchen, und die einzige Haltung, die dahinter zu entdecken ist, ist Ironie. Die einzige Aussage ist dann, dass diese Generation orientierungslos ist und sich ihr Leben zusammensampelt.
Neumann: Das war für mich eigentlich der Ausgangspunkt, selber zu schreiben, dass ich das Theater der 90er-Jahre viel zu oft als ironisch oder zynisch erlebt habe. Ich habe vermisst, dass Geschichten erzählt werden, die etwas zu tun haben mit dem Menschen, der da unten sitzt, die man ernst nimmt. Das Theater ist für mich einer der letzten werbefreien Räume, die wir haben, und diesen Raum gilt es zu schützen. Und es gibt eine große Sehnsucht, auch des Publikums, nach Geschichten, die mehr sind als eine glatte, abwehrende Oberfläche, nach einem Pfeil mit Widerhaken. Man macht es sich mit dieser zynischen Haltung zu leicht.
Was ist mit zynischem Theater gemeint?
Neumann: Ich fand das in den 90er-Jahren schon sehr stark, gar nicht in erster Linie bei den Autoren, sondern eher in der Art, wie Theater gemacht wurde, dass alles auf Distanz gehalten wurde. Ich habe ja als Schauspieler angefangen und in dieser Zeit sehr oft erlebt, dass ich Regisseure vor mir sitzen hatte, die kein Interesse hatten an einem Text oder an einer Figur, oft nicht einmal an einem Schauspieler, sondern in erster Linie an ihrem gelackten Mercedes vor der Tür.
Hübner: Das war nicht nur eine Regiemarotte, sondern auch eine Tendenz der Kritik, dass Geschichten, die einfach waren oder berühren wollten, fast reflexhaft weggebissen wurden mit der Haltung: Wenn es nicht wehtut, kann es keine Kunst sein. Ich hatte immer das Gefühl, dass da unten im Parkett die abgebrühten SMm-Freier sitzen, die es jetzt härter brauchen. Dann kannst du aber als Autor und auch als Schauspieler eigentlich keine Figuren entwickeln, weil Figuren sich nicht ständig in Extrembereichen bewegen.
Woher kommt dieser Beißreflex?
Hübner: Das scheint mir schon spezifisch deutsch, auch dass Komödien hier extrem schnell weggebissen werden, mit denen die Engländer beispielsweise nicht das geringste Problem haben. Es darf nicht zu komisch sein oder zu berührend, dann ist es populistisch.
Aber ist es nicht auch eine berechtigte Forderung, dass das Theater Grenzen testen soll und auch formal verstörender sein muss als kommerzialisiertes Geschichtenerzählen im Fernsehen? Bietet dieser Ort nicht gerade die Möglichkeit, Formen zu erfinden jenseits von klassischer Dramaturgie und Rollenpsychologie? Muss dieser Freiraum nicht noch viel radikaler genutzt werden? Oder worin besteht der Unterschied zu Film und Fernsehen?
Laucke: Ich habe ein Drehbuch geschrieben, und das Wichtigste an dieser Erfahrung ist die Einsicht, warum die Dinger oft so platt sind: weil da so viele Leute reinquatschen, dass du irgendwann machst, was die dir sagen. Und dass fast ausschließlich über einen möglichst breiten Zuschauerzuspruch nachgedacht wird, bis in die Details der Geschichten hinein.
Hübner: Fernsehen hat eine ganz andere Sprache und es ist eine Industrie, aber ich würde es nicht gegen das Theater ausspielen. Es gibt in beiden Bereichen gelungene Produktionen. Das Besondere der Theatererfahrung ist doch, dass ich 100 oder mehr atmende Menschen neben mir habe und dass das Geschehen auf der Bühne mir näherkommt als auf der Mattscheibe. Das ist der Push, dass es diese Art der gemeinsamen Konzentration gibt. Aber die Verstörung durch einen schockierenden Regieeinfall macht dieses Gemeinsame oft kaputt. Und Verstörung ist nicht per se eine Qualität. Die Härte muss sich aus der Geschichte ergeben und darf kein reiner Geschmacksverstärker sein. Mit diesen Schockeffekten schließt man auch ein bestimmtes Publikum automatisch aus.
Palmetshofer: Ich glaube, im Kern hat der Film einfach kein Sprachproblem, oder anders gesagt: Das Sprechen ist im Film kein Problem oder stellt sich als unproblematisch dar. Im Film dominiert das Bild über das Wort. Und dieses Bild geht mittlerweile bis in die dritte Dimension, in den Hyperrealismus, egal wie imaginär diese Bilder auch sein mögen. Oder wie gebrochen, wenn z. B. versucht wird, Authentizität darzustellen. Für mich ist Theater dem Wort ausgesetzt und dem Problem, dass wir sprechen bzw. sprechen müssen. Das ist auch das, was mich daran interessiert.
Ich finde auch, dass Sprechen auf der Bühne seine Selbstverständlichkeit verliert und auch der Repräsentationsgedanke in ganz anderer Weise infrage steht. Nur weiß ich nicht, ob und wie der Zuschauer sich für diese theaterinternen Probleme noch interessiert. Habt ihr beim Schreiben ein Publikum im Kopf? Wisst ihr, für wen ihr schreibt oder wen ihr ins Gespräch bringen wollt?
Freyer: Ich habe kein Publikum im Kopf, vielleicht auch weil ich weiß, dass meine Fassung zuerst einmal zu meinem Regisseur kommt. Das ist wichtig für mich, dass ich mit Tilmann Köhler einen mir vertrauten Gesprächspartner habe. Und aus unserer Erfahrung weiß ich, welche Impulse es in der Zusammenarbeit noch nicht gab und welche Sichtweisen noch fehlen.
Laucke: Ich finde es auch schwierig, über Kollektive zu urteilen, dass die so oder so auf die Bühne schauen, auch wenn ich manchmal schon denke, den bürgerlichen Spinnern kannst du mal ordentlich an den Latz kacken. Aber eigentlich schreibe ich die Geschichten, die mir selber gefallen. Das ist das wichtigste Kriterium.
Palmetshofer: Wer das jeweilige Publikum sein wird, kann ich auch nicht sagen. Aber ich versuche, mir vorzustellen, wozu ich das Publikum dort oder da bringen will. Oder verführen. Im besten Fall wäre das so eine Art Arbeit. Dass sich der Theaterabend erst in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer zusammensetzt. Und dass das ohne ihre Arbeit nicht geht.
Neumann: Die direkte Verbindung zum Publikum hat der Schauspieler, deshalb denke ich beim Schreiben auch in erster Linie aus dieser Perspektive. Ich will mich in diesen Figuren sehen und gerne den Weg gehen mit ihnen.
Hübner: Ich entwerfe die Stücke gemeinsam mit meiner Frau, ich arbeite sehr früh mit einem Dramaturgen und mit einem Regisseur zusammen, insofern sind die Ansprechpartner schon in der Schreibphase konkret anwesend. Ich muss die Geschichte sehr früh jemandem erzählen können, und wenn ich nach zwei Sätzen hängen bleibe, dann weiß ich, dass die Geschichte nicht stimmt.
Und hat die Stadt Dresden Einfluss auf euren Text, wenn ihr für das Staatsschauspiel schreibt?
Laucke: Ich frage mich schon, was die Stadt bewegt und was da ein Thema ist. An Dresden z. B. finde ich diese Randlage interessant, aber auch die Spanne zwischen der Kulturstadt und dem Naziaufmarsch am 13. Februar. Da hilft es mir, dass ich im Osten aufgewachsen bin und mich den Leuten vertraut fühle.
Freyer: Aber es liegt auch schnell etwas Vermessenes in diesem Anspruch, aus der Entfernung etwas über eine Stadt sagen zu können.
Palmetshofer: Bei mir ist es dann noch so, dass ich Österreicher bin. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Ich kann da nicht meinen Blick auf diese Stadt anbieten. Das würde keinen interessieren und ohnehin niemand glauben. Da kann ich nur etwas von mir mitnehmen und hoffen, dass das dann was taugt.
Neumann: Ich kenne Dresden zu wenig, aber eine fremde Stadt kann schon Einfluss haben auf den Text, speziell natürlich wenn man wie ich den eigenen Text in dieser Stadt schreibt und inszeniert.
Was habt ihr für Erfahrungen mit euren Regisseuren? Oder was erwartet ihr von einem guten Regisseur?
Neumann: Wenn ich eigene Texte von mir inszeniere, kann ich ziemlich gnadenlos sein. Während ich mit fremden Texten eigentlich sehr vorsichtig umgehe. Und das erwarte ich eigentlich auch von einem anderen Regisseur, dass er zuerst einmal sehr genau hinschaut. Bei neuen Texten vor allem, denn die alten hat man ja in der Regel schon einmal gesehen oder gelesen, aber eine Uraufführung sollte doch erst einmal den Text ernst nehmen, den es vorzustellen gilt. Und wenn das nicht gelingt, will ich wenigstens das Bemühen um Genauigkeit auf der Bühne sehen können.
Hübner: Ich habe meine ersten Stücke auch selbst inszeniert, aber inzwischen bin ich froh, Regisseure zu haben, die etwas weiterentwickeln, was ich nicht mehr weitererfinden kann, dass noch eine andere Fantasie zu dem Text hinzukommt. Ich habe mit dem Text alles gesagt, was ich zu sagen habe.
Freyer: Meine Fantasie ist eigentlich auch fertig, wenn ich den Text geschrieben habe. Ich freue mich, wenn dann ein Regisseur kommt, der mit dem Text arbeitet und auch etwas dagegenstellen kann und sich auseinandersetzt. Bei sehr jungen Regisseuren fehlt da oft die Geduld. Und oft sehe ich auch nicht, warum sie Texte inszenieren – außer um ihren Platz im Theater zu finden.
Palmetshofer: Ich hoffe immer, dass die Regie sich an derselben Frage abarbeiten will, die auch mein Text zu umkreisen versucht. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Und dann wären Text und Regie derselben Sache verpflichtet. Und die Regie nicht einfach nur dem Text. Sondern diesem Dritten. Und manchmal findet sich das auch.
Hübner: Ich finde es extrem hilfreich, eine langjährige Verbindung zu Häusern und zu Regisseuren zu entwickeln, damit Vertrauen entsteht. Auf dieser Grundlage fällt es mir auch leichter, Neues auszuprobieren. Für Hannover habe ich über neun Jahre immer wieder Stücke geschrieben, und spätestens nach dem zweiten Erfolg wird einem auch die Abweichung oder ein Experiment zugestanden.
Hat sich die Position des Autors verändert? Ich frage das auch, weil sich einige der 70-jährigen Kollegen noch regelmäßig in der Öffentlichkeit streiten und Stellung nehmen zu den prominenten politischen Themen, während wir hier schon so lange friedlich beisammensitzen.
Laucke: Ich würde schon Ärger machen, wenn ich wüsste, der Lutz Hübner ist voll die rechtskonservative Sau, aber das ist er einfach nicht.
Hübner: Und diese Auseinandersetzungen der alten Autoren kommen mir eher vor wie Rüdenkämpfe, da geht es doch selten um inhaltliche Differenzen. Und auch diese Gruppenbildungen der 1920er-Jahre, bei denen einer zum Häuptling wird, um die anderen auszuschließen, das sind Prozesse, die Theaterautoren wesensfremd sind.
Neumann: Es geht doch nicht darum, eine Position zu vertreten, sondern unterschiedliche Positionen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Und es interessiert mich eigentlich mehr, eine fremde Position im Schreiben zu überprüfen, die ich selbst nicht teile. Oder von der Schwierigkeit zu erzählen, eine Position einzunehmen.
Palmetshofer: Aber ich glaube schon, dass ein Stück in irgendeiner Weise eine Position einnimmt oder eine Position ist. Und manchmal reibt es dann auch zwischen Stücken. Oder ich reibe mich an dem, was ich als Position unterstelle. In Autorenprojekten gab es darum hin und wieder durchaus Streit, oder auf Proben oder in Dramaturgiesitzungen. Nur nicht öffentlich. Vielleicht gibt es jenseits dessen wenig öffentlichen Streit, wenn man mal von diversen Internetforen absieht, weil das alles irgendwie auch eine Einsamkeitsmaschine ist.
Hübner: In meinem Stück über die Berliner Bankenkrise habe ich am deutlichsten gespürt, was es heißt, Teil einer Debatte zu werden. Aber auch dieser Text war eher eine Aufforderung zum Gespräch als die Verkündigung einer Wahrheit. Theater kann eine Diskussion in Gang setzen, aber auf der Bühne muss jede Figur recht haben. Die Moral steckt in der Perspektive auf die Figuren.
Laucke: Ich habe schon den Anspruch, dass für etwas gestritten wird in den Texten. Dass es Figuren gibt, die nicht klarkommen oder für etwas kämpfen. Oder die einer Ideologie anhängen und an den Umständen scheitern. Ein Stück sollte doch versuchen, etwas aufzureißen oder um Alternativen zu kämpfen.
Freyer: Ich hab nur einmal konkret versucht, in einem Stück eine Utopie zu entwerfen, und es ist ein Märchen daraus geworden.
Warum müssen denn überhaupt immer wieder neue Geschichten erzählt werden?
Hübner: Man kann keine neuen Geschichten erzählen, man überprüft nur die alten Geschichten, um herauszufinden, was sie noch zu sagen haben.
Palmetshofer: Ich sehe mich eigentlich gar nicht als Geschichtenerzähler. Ich würde eher sagen: Man muss immer wieder Fragen stellen.
Neumann: Vielleicht ist es nur die Art zu erzählen, die Sprache, der Blick auf einen Sachverhalt, der sich ändert, und damit eine Notwendigkeit des Wiederbetrachtens, die wichtig ist: aus der Zeit heraus und in die Zeit hinein erzählen, in der man lebt – wieder und wieder.
Laucke: Ich glaube, die Geschichten, die ich erzähle, sind auf jeden Fall schon irgendwie mal erzählt worden. Die verdammten Griechen haben doch schon alles abgedeckt, aber ich habe das Gefühl, die Art und Weise, wie ich die Geschichten erzählen würde, sagen auf jeden Fall etwas über den Zustand der Welt jetzt aus. Und über die Welt bin ich nun mal verunsichert, verwirrt und wütend. Und außerdem komme ich doch aus dem Jetzt. Hoffentlich.
Freyer: Ich habe kein Publikum im Kopf, vielleicht auch weil ich weiß, dass meine Fassung zuerst einmal zu meinem Regisseur kommt. Das ist wichtig für mich, dass ich mit Tilmann Köhler einen mir vertrauten Gesprächspartner habe. Und aus unserer Erfahrung weiß ich, welche Impulse es in der Zusammenarbeit noch nicht gab und welche Sichtweisen noch fehlen.
Laucke: Ich finde es auch schwierig, über Kollektive zu urteilen, dass die so oder so auf die Bühne schauen, auch wenn ich manchmal schon denke, den bürgerlichen Spinnern kannst du mal ordentlich an den Latz kacken. Aber eigentlich schreibe ich die Geschichten, die mir selber gefallen. Das ist das wichtigste Kriterium.
Palmetshofer: Wer das jeweilige Publikum sein wird, kann ich auch nicht sagen. Aber ich versuche, mir vorzustellen, wozu ich das Publikum dort oder da bringen will. Oder verführen. Im besten Fall wäre das so eine Art Arbeit. Dass sich der Theaterabend erst in den Köpfen der Zuschauerinnen und Zuschauer zusammensetzt. Und dass das ohne ihre Arbeit nicht geht.
Neumann: Die direkte Verbindung zum Publikum hat der Schauspieler, deshalb denke ich beim Schreiben auch in erster Linie aus dieser Perspektive. Ich will mich in diesen Figuren sehen und gerne den Weg gehen mit ihnen.
Hübner: Ich entwerfe die Stücke gemeinsam mit meiner Frau, ich arbeite sehr früh mit einem Dramaturgen und mit einem Regisseur zusammen, insofern sind die Ansprechpartner schon in der Schreibphase konkret anwesend. Ich muss die Geschichte sehr früh jemandem erzählen können, und wenn ich nach zwei Sätzen hängen bleibe, dann weiß ich, dass die Geschichte nicht stimmt.
Und hat die Stadt Dresden Einfluss auf euren Text, wenn ihr für das Staatsschauspiel schreibt?
Laucke: Ich frage mich schon, was die Stadt bewegt und was da ein Thema ist. An Dresden z. B. finde ich diese Randlage interessant, aber auch die Spanne zwischen der Kulturstadt und dem Naziaufmarsch am 13. Februar. Da hilft es mir, dass ich im Osten aufgewachsen bin und mich den Leuten vertraut fühle.
Freyer: Aber es liegt auch schnell etwas Vermessenes in diesem Anspruch, aus der Entfernung etwas über eine Stadt sagen zu können.
Palmetshofer: Bei mir ist es dann noch so, dass ich Österreicher bin. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Ich kann da nicht meinen Blick auf diese Stadt anbieten. Das würde keinen interessieren und ohnehin niemand glauben. Da kann ich nur etwas von mir mitnehmen und hoffen, dass das dann was taugt.
Neumann: Ich kenne Dresden zu wenig, aber eine fremde Stadt kann schon Einfluss haben auf den Text, speziell natürlich wenn man wie ich den eigenen Text in dieser Stadt schreibt und inszeniert.
Was habt ihr für Erfahrungen mit euren Regisseuren? Oder was erwartet ihr von einem guten Regisseur?
Neumann: Wenn ich eigene Texte von mir inszeniere, kann ich ziemlich gnadenlos sein. Während ich mit fremden Texten eigentlich sehr vorsichtig umgehe. Und das erwarte ich eigentlich auch von einem anderen Regisseur, dass er zuerst einmal sehr genau hinschaut. Bei neuen Texten vor allem, denn die alten hat man ja in der Regel schon einmal gesehen oder gelesen, aber eine Uraufführung sollte doch erst einmal den Text ernst nehmen, den es vorzustellen gilt. Und wenn das nicht gelingt, will ich wenigstens das Bemühen um Genauigkeit auf der Bühne sehen können.
Hübner: Ich habe meine ersten Stücke auch selbst inszeniert, aber inzwischen bin ich froh, Regisseure zu haben, die etwas weiterentwickeln, was ich nicht mehr weitererfinden kann, dass noch eine andere Fantasie zu dem Text hinzukommt. Ich habe mit dem Text alles gesagt, was ich zu sagen habe.
Freyer: Meine Fantasie ist eigentlich auch fertig, wenn ich den Text geschrieben habe. Ich freue mich, wenn dann ein Regisseur kommt, der mit dem Text arbeitet und auch etwas dagegenstellen kann und sich auseinandersetzt. Bei sehr jungen Regisseuren fehlt da oft die Geduld. Und oft sehe ich auch nicht, warum sie Texte inszenieren – außer um ihren Platz im Theater zu finden.
Palmetshofer: Ich hoffe immer, dass die Regie sich an derselben Frage abarbeiten will, die auch mein Text zu umkreisen versucht. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Und dann wären Text und Regie derselben Sache verpflichtet. Und die Regie nicht einfach nur dem Text. Sondern diesem Dritten. Und manchmal findet sich das auch.
Hübner: Ich finde es extrem hilfreich, eine langjährige Verbindung zu Häusern und zu Regisseuren zu entwickeln, damit Vertrauen entsteht. Auf dieser Grundlage fällt es mir auch leichter, Neues auszuprobieren. Für Hannover habe ich über neun Jahre immer wieder Stücke geschrieben, und spätestens nach dem zweiten Erfolg wird einem auch die Abweichung oder ein Experiment zugestanden.
Hat sich die Position des Autors verändert? Ich frage das auch, weil sich einige der 70-jährigen Kollegen noch regelmäßig in der Öffentlichkeit streiten und Stellung nehmen zu den prominenten politischen Themen, während wir hier schon so lange friedlich beisammensitzen.
Laucke: Ich würde schon Ärger machen, wenn ich wüsste, der Lutz Hübner ist voll die rechtskonservative Sau, aber das ist er einfach nicht.
Hübner: Und diese Auseinandersetzungen der alten Autoren kommen mir eher vor wie Rüdenkämpfe, da geht es doch selten um inhaltliche Differenzen. Und auch diese Gruppenbildungen der 1920er-Jahre, bei denen einer zum Häuptling wird, um die anderen auszuschließen, das sind Prozesse, die Theaterautoren wesensfremd sind.
Neumann: Es geht doch nicht darum, eine Position zu vertreten, sondern unterschiedliche Positionen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Und es interessiert mich eigentlich mehr, eine fremde Position im Schreiben zu überprüfen, die ich selbst nicht teile. Oder von der Schwierigkeit zu erzählen, eine Position einzunehmen.
Palmetshofer: Aber ich glaube schon, dass ein Stück in irgendeiner Weise eine Position einnimmt oder eine Position ist. Und manchmal reibt es dann auch zwischen Stücken. Oder ich reibe mich an dem, was ich als Position unterstelle. In Autorenprojekten gab es darum hin und wieder durchaus Streit, oder auf Proben oder in Dramaturgiesitzungen. Nur nicht öffentlich. Vielleicht gibt es jenseits dessen wenig öffentlichen Streit, wenn man mal von diversen Internetforen absieht, weil das alles irgendwie auch eine Einsamkeitsmaschine ist.
Hübner: In meinem Stück über die Berliner Bankenkrise habe ich am deutlichsten gespürt, was es heißt, Teil einer Debatte zu werden. Aber auch dieser Text war eher eine Aufforderung zum Gespräch als die Verkündigung einer Wahrheit. Theater kann eine Diskussion in Gang setzen, aber auf der Bühne muss jede Figur recht haben. Die Moral steckt in der Perspektive auf die Figuren.
Laucke: Ich habe schon den Anspruch, dass für etwas gestritten wird in den Texten. Dass es Figuren gibt, die nicht klarkommen oder für etwas kämpfen. Oder die einer Ideologie anhängen und an den Umständen scheitern. Ein Stück sollte doch versuchen, etwas aufzureißen oder um Alternativen zu kämpfen.
Freyer: Ich hab nur einmal konkret versucht, in einem Stück eine Utopie zu entwerfen, und es ist ein Märchen daraus geworden.
Warum müssen denn überhaupt immer wieder neue Geschichten erzählt werden?
Hübner: Man kann keine neuen Geschichten erzählen, man überprüft nur die alten Geschichten, um herauszufinden, was sie noch zu sagen haben.
Palmetshofer: Ich sehe mich eigentlich gar nicht als Geschichtenerzähler. Ich würde eher sagen: Man muss immer wieder Fragen stellen.
Neumann: Vielleicht ist es nur die Art zu erzählen, die Sprache, der Blick auf einen Sachverhalt, der sich ändert, und damit eine Notwendigkeit des Wiederbetrachtens, die wichtig ist: aus der Zeit heraus und in die Zeit hinein erzählen, in der man lebt – wieder und wieder.
Laucke: Ich glaube, die Geschichten, die ich erzähle, sind auf jeden Fall schon irgendwie mal erzählt worden. Die verdammten Griechen haben doch schon alles abgedeckt, aber ich habe das Gefühl, die Art und Weise, wie ich die Geschichten erzählen würde, sagen auf jeden Fall etwas über den Zustand der Welt jetzt aus. Und über die Welt bin ich nun mal verunsichert, verwirrt und wütend. Und außerdem komme ich doch aus dem Jetzt. Hoffentlich.
Über das Theater des Regisseurs Tilmann Köhler
Über das Theater des Regisseurs Tilmann Köhler
von Klaus Völker
von Klaus Völker
Dieser Text ist ein Auszug aus der Laudatio, die Klaus Völker anlässlich der Verleihung des Kurt-Hübner-Regiepreises für junge Regisseure 2009 an Tilmann Köhler im März 2010 in Bensheim hielt.
Den Kurt-Hübner-Preis 2009 erhält Tilmann Köhler für seine Inszenierung von Bertolt Brechts Schauspiel „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ am Staatsschauspiel Dresden. Tilmann Köhler ist 30 Jahre alt, er wurde im Dezember 1979 in Weimar geboren und studierte von 2001 bis 2005 Regie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Eine Inszenierung des Regiestudenten Köhler, „Die Choephoren“, der Mittelteil der „Orestie“ von Aischylos, war 2004 im Parktheater Bensheim zu sehen, die Aufführung erhielt in jenem Jahr den Bensheimer Theaterpreis. Für seine Diplominszenierung wählte Köhler dann die rigorose und von tiefer Leidenschaft durchglühte Kleist’sche Tragödie „Penthesilea“, die er mit einer Gruppe mitverschworener Schauspielabsolventen seines Jahrgangs sprach- und spielwütig auf die Bühne brachte. Von einer Stelle aus Kleists Tragödie, die vom ungerecht frühen Vergehen jugendlicher Energie und Vitalität handelt, war er ganz besonders beeindruckt: „Die abgestorbene Eiche steht im Sturm, doch die gesunde stürzt er schmetternd nieder.“ War solche Haltung radikal jung? Mir erschien der Ernst, mit dem das „Penthesilea“-Team damals an die Arbeit ging, als das Bewundernswerte; Regisseur und Darsteller brannten alle leidenschaftlich für die Sache und verfassten auch ein, sicher humorloses, Manifest gegen die, die ironisches und zynisches Theater machten und klüger als die Autoren sein wollten: „Wir werden mit unseren Versuchen selber auf die Fresse fallen und uns nicht von Resignierten den Sturz aufzwingen lassen.“
„Penthesilea“ war ein großer Erfolg – die Besessenheit für den Text überzeugte, die körperliche Wucht und Intensität, die geradezu beängstigende Gewaltsamkeit und Unbedingtheit der Gefühle gingen einem nahe, schlugen in Bann, überrumpelten den Zuschauer aber nicht, sondern verdeutlichten, dass es hier um Dichtung und um eine Kunst ging, die kein „richtig“ oder „falsch“ kennt: „Es gibt nur ein Lebendig und ein Tot.“ Der Weimarer Intendant Stefan Märki zögerte nicht lange, er engagierte Köhler und seine Gruppe ab der Spielzeit 2005.2006.
Der Start von Tilmann Köhler am Nationaltheater Weimar war fulminant: Er inszenierte hier mit wunderbarer Zartheit und gewaltigem Theaterzauber Jewgenij Schwarz’ Märchenkomödie „Der Drache“ und Shakespeares „Othello“. Fast ohne Requisiten kommt das Theater des Tilmann Köhler aus, er bringt die Körper der Schauspieler ins Spiel. Sehr überzeugend gelang ihm das mit der Inszenierung von Ferdinand Bruckners Tragödie „Krankheit der Jugend“, mit der er 2007 zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Die Bühne, wie immer bei Tilmann Köhler von Karoly Risz entworfen, war ein fahlblau ausgeleuchtetes Spielfeld, eine Art Schwimmbecken und gleichzeitig Anatomiesaal, in den die Zuschauer von vier Seiten herabblickten, in der Mitte ein Seziertisch auf Rädern, darauf ein Mädchenkörper, über den sechs junge Menschen schnüffelnd und knabbernd sich hermachten. Eine „dumb show“ wie im elisabethanischen Theater, die das böse Ende vorwegnahm. Dann wurde die Geschichte der Wohngemeinschaft von sieben Studenten, ihren exaltierten und chaotisch ineinander verknoteten Liebes- und Abhängigkeitsverhältnissen erzählt wie ein höllischer Reigen flüchtiger Beziehungen und verfehlter Sehnsüchte.
Sogleich erklärte die Fachzeitschrift „Theater heute“ Köhler auch zum „jungen Shooting Star“, dessen Erfolgsstory „das Zeug zur Legendenbildung“ habe. So übereilt und schnell die überregionale Kritik ihn nun abfeierte und ihn als „das Glück von Weimar“ bezeichnete, so schnell war er für die, die ihn eben noch priesen, gealtert; einer, dessen Theaterzauber und Energie sie zwar noch hervorhoben, aber schon bald „ermüdend“ fanden. Er war dann eben nur ein „Hausregisseur“ in Weimar, der nicht nur seinen Schauspielern Matthias Reichwald, Antje Trautmann, Thomas Braungardt, Ina Piontek, Eve Kolb und Paul Enke die Treue hielt, sondern auch dem etwa gleichaltrigen Autor Thomas Freyer. Von ihm inszenierte er drei Stücke: den Erstling „Amoklauf mein Kinderspiel“, dann „Separatisten“ und im November 2008 in Hannover auch Freyers eine völlig aussichtslose Separatistenwelt darstellende Kindertragödie „Und in den Nächten liegen wir stumm“. Diese Stücke nur zu lesen genügte Tilmann Köhler nicht, es lockte ihn, mehr von den Ängsten und Sehnsüchten junger Menschen von heute zu erfahren, um Stücke und Figuren anderer Zeiten, die ihm mehr bedeuten, damit aufzuladen und näher an die Gegenwart heranzuholen.
Der Neuanfang 2009 in Dresden mit Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ hat die gleiche zupackende Kraft und Entschiedenheit, mit der uns Köhler Sprache und Welt der Stücke von Kleist, Shakespeare oder Ferdinand Bruckner nahebrachte. Mit der „Johanna der Schlachthöfe“ lieferte Brecht 1931/32 die Synthese seiner Lehrstücke, die Parodie einer klassischen Tragödie (nämlich der Schiller’schen „Jungfrau von Orleans“) und einen parodistischen Kommentar zur Rettung Fausts, damit „die heutige Entwicklung des faustischen Menschen“ zeigend. Indem er klassische Formen parodierte, schuf Brecht sich eine Möglichkeit, die Weltwirtschaftskrise und die schwer durchschaubaren Marktmechanismen in einer Bühnenhandlung darzustellen. Mit großem Ernst und hohem sprachlichem Pathos. Dem Stück und der Sprachkraft Brechts trauend, lieferte Tilmann Köhler als einziger der Regisseure, die Brechts „Heilige Johanna“ als aktuelles Drama zur Finanzkrise in dieser Spielzeit auf die Bühne brachten, ein aufregendes Gegenwartsstück mit politischer Brisanz, ohne jede Besserwisserei. Christine Dössel beschrieb die Aufführung in der Süddeutschen Zeitung sehr treffend: „Tilmann Köhler geht den Stoff mit einer solchen Wucht, Wut und Ernsthaftigkeit an, als gelte es, nicht nur unsere Gegenwart knallhart darin zu spiegeln, sondern dezidiert auch Brecht zu rehabilitieren. Zwar vermeidet Köhler den Agitprop und reizt auch sonst den Belehrungsdrang des epischen Theaters nicht aus, doch so nah am Wort und ohne aktualisierende Eingriffe, wie er das Stück in fast ungekürzter Länge inszeniert, spricht das für ein großes Textvertrauen – auch wenn die Schauspieler zwischendurch schon mal mit einem ‚Verstehst du das jetzt?‘ die Abläufe hinterfragen. Köhler geht mit seinem hochenergetischen Ensemble in den Text, ohne vorzugeben, selber mehr zu wissen. Die Authentizität dieser Suche vermittelt sich: es ist eine tolle Inszenierung mit starken, bezwingenden Bildern und einem fulminanten Chor- und Körpereinsatz des Ensembles.“
Den Kurt-Hübner-Preis 2009 erhält Tilmann Köhler für seine Inszenierung von Bertolt Brechts Schauspiel „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ am Staatsschauspiel Dresden. Tilmann Köhler ist 30 Jahre alt, er wurde im Dezember 1979 in Weimar geboren und studierte von 2001 bis 2005 Regie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Eine Inszenierung des Regiestudenten Köhler, „Die Choephoren“, der Mittelteil der „Orestie“ von Aischylos, war 2004 im Parktheater Bensheim zu sehen, die Aufführung erhielt in jenem Jahr den Bensheimer Theaterpreis. Für seine Diplominszenierung wählte Köhler dann die rigorose und von tiefer Leidenschaft durchglühte Kleist’sche Tragödie „Penthesilea“, die er mit einer Gruppe mitverschworener Schauspielabsolventen seines Jahrgangs sprach- und spielwütig auf die Bühne brachte. Von einer Stelle aus Kleists Tragödie, die vom ungerecht frühen Vergehen jugendlicher Energie und Vitalität handelt, war er ganz besonders beeindruckt: „Die abgestorbene Eiche steht im Sturm, doch die gesunde stürzt er schmetternd nieder.“ War solche Haltung radikal jung? Mir erschien der Ernst, mit dem das „Penthesilea“-Team damals an die Arbeit ging, als das Bewundernswerte; Regisseur und Darsteller brannten alle leidenschaftlich für die Sache und verfassten auch ein, sicher humorloses, Manifest gegen die, die ironisches und zynisches Theater machten und klüger als die Autoren sein wollten: „Wir werden mit unseren Versuchen selber auf die Fresse fallen und uns nicht von Resignierten den Sturz aufzwingen lassen.“
„Penthesilea“ war ein großer Erfolg – die Besessenheit für den Text überzeugte, die körperliche Wucht und Intensität, die geradezu beängstigende Gewaltsamkeit und Unbedingtheit der Gefühle gingen einem nahe, schlugen in Bann, überrumpelten den Zuschauer aber nicht, sondern verdeutlichten, dass es hier um Dichtung und um eine Kunst ging, die kein „richtig“ oder „falsch“ kennt: „Es gibt nur ein Lebendig und ein Tot.“ Der Weimarer Intendant Stefan Märki zögerte nicht lange, er engagierte Köhler und seine Gruppe ab der Spielzeit 2005.2006.
Der Start von Tilmann Köhler am Nationaltheater Weimar war fulminant: Er inszenierte hier mit wunderbarer Zartheit und gewaltigem Theaterzauber Jewgenij Schwarz’ Märchenkomödie „Der Drache“ und Shakespeares „Othello“. Fast ohne Requisiten kommt das Theater des Tilmann Köhler aus, er bringt die Körper der Schauspieler ins Spiel. Sehr überzeugend gelang ihm das mit der Inszenierung von Ferdinand Bruckners Tragödie „Krankheit der Jugend“, mit der er 2007 zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Die Bühne, wie immer bei Tilmann Köhler von Karoly Risz entworfen, war ein fahlblau ausgeleuchtetes Spielfeld, eine Art Schwimmbecken und gleichzeitig Anatomiesaal, in den die Zuschauer von vier Seiten herabblickten, in der Mitte ein Seziertisch auf Rädern, darauf ein Mädchenkörper, über den sechs junge Menschen schnüffelnd und knabbernd sich hermachten. Eine „dumb show“ wie im elisabethanischen Theater, die das böse Ende vorwegnahm. Dann wurde die Geschichte der Wohngemeinschaft von sieben Studenten, ihren exaltierten und chaotisch ineinander verknoteten Liebes- und Abhängigkeitsverhältnissen erzählt wie ein höllischer Reigen flüchtiger Beziehungen und verfehlter Sehnsüchte.
Sogleich erklärte die Fachzeitschrift „Theater heute“ Köhler auch zum „jungen Shooting Star“, dessen Erfolgsstory „das Zeug zur Legendenbildung“ habe. So übereilt und schnell die überregionale Kritik ihn nun abfeierte und ihn als „das Glück von Weimar“ bezeichnete, so schnell war er für die, die ihn eben noch priesen, gealtert; einer, dessen Theaterzauber und Energie sie zwar noch hervorhoben, aber schon bald „ermüdend“ fanden. Er war dann eben nur ein „Hausregisseur“ in Weimar, der nicht nur seinen Schauspielern Matthias Reichwald, Antje Trautmann, Thomas Braungardt, Ina Piontek, Eve Kolb und Paul Enke die Treue hielt, sondern auch dem etwa gleichaltrigen Autor Thomas Freyer. Von ihm inszenierte er drei Stücke: den Erstling „Amoklauf mein Kinderspiel“, dann „Separatisten“ und im November 2008 in Hannover auch Freyers eine völlig aussichtslose Separatistenwelt darstellende Kindertragödie „Und in den Nächten liegen wir stumm“. Diese Stücke nur zu lesen genügte Tilmann Köhler nicht, es lockte ihn, mehr von den Ängsten und Sehnsüchten junger Menschen von heute zu erfahren, um Stücke und Figuren anderer Zeiten, die ihm mehr bedeuten, damit aufzuladen und näher an die Gegenwart heranzuholen.
Der Neuanfang 2009 in Dresden mit Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ hat die gleiche zupackende Kraft und Entschiedenheit, mit der uns Köhler Sprache und Welt der Stücke von Kleist, Shakespeare oder Ferdinand Bruckner nahebrachte. Mit der „Johanna der Schlachthöfe“ lieferte Brecht 1931/32 die Synthese seiner Lehrstücke, die Parodie einer klassischen Tragödie (nämlich der Schiller’schen „Jungfrau von Orleans“) und einen parodistischen Kommentar zur Rettung Fausts, damit „die heutige Entwicklung des faustischen Menschen“ zeigend. Indem er klassische Formen parodierte, schuf Brecht sich eine Möglichkeit, die Weltwirtschaftskrise und die schwer durchschaubaren Marktmechanismen in einer Bühnenhandlung darzustellen. Mit großem Ernst und hohem sprachlichem Pathos. Dem Stück und der Sprachkraft Brechts trauend, lieferte Tilmann Köhler als einziger der Regisseure, die Brechts „Heilige Johanna“ als aktuelles Drama zur Finanzkrise in dieser Spielzeit auf die Bühne brachten, ein aufregendes Gegenwartsstück mit politischer Brisanz, ohne jede Besserwisserei. Christine Dössel beschrieb die Aufführung in der Süddeutschen Zeitung sehr treffend: „Tilmann Köhler geht den Stoff mit einer solchen Wucht, Wut und Ernsthaftigkeit an, als gelte es, nicht nur unsere Gegenwart knallhart darin zu spiegeln, sondern dezidiert auch Brecht zu rehabilitieren. Zwar vermeidet Köhler den Agitprop und reizt auch sonst den Belehrungsdrang des epischen Theaters nicht aus, doch so nah am Wort und ohne aktualisierende Eingriffe, wie er das Stück in fast ungekürzter Länge inszeniert, spricht das für ein großes Textvertrauen – auch wenn die Schauspieler zwischendurch schon mal mit einem ‚Verstehst du das jetzt?‘ die Abläufe hinterfragen. Köhler geht mit seinem hochenergetischen Ensemble in den Text, ohne vorzugeben, selber mehr zu wissen. Die Authentizität dieser Suche vermittelt sich: es ist eine tolle Inszenierung mit starken, bezwingenden Bildern und einem fulminanten Chor- und Körpereinsatz des Ensembles.“
Tilmann Köhler ist seit 2009 Hausregisseur am Staatsschauspiel Dresden und, zusammen mit Jens Groß, verantwortlich für die Leitung des Schauspielstudios Dresden der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. Im März 2010 hatte die erste Regiearbeit Köhlers mit den ihm anvertrauten Studierenden Premiere: „Italienische Nacht“ von Horváth. Außer dass zu Beginn mit filmischen Bildern von den Aufmärschen der Neonazis in Dresden der Gegenwartsbezug hergestellt wird und gleichzeitig das junge zehnköpfige Ensemble in heutiger Kostümierung mit Transistorradios Aufstellung nimmt, verzichtet Köhler auf jede Art von Aktualisierung und vertraut ganz dem Stück und der Sprache seiner Figuren. Und dadurch ergibt sich eine Wirkung wie von heute. Die Akrobatik, der körperliche Einsatz, das Sportive und der enorme Schwung der Spieler verselbstständigen sich nie. Besser als Irene Bazinger in der FAZ kann man es nicht beschreiben: „Die Darsteller, zum Teil in mehreren Rollen, legen ein hohes Tempo und viel Witz an den Tag und werden von Köhler in griffigen, einfallsreichen Choreographien – ganz im Sinne des Autors – sehr stilisiert geführt.“
Tilmann Köhlers Inszenierungen haben kein stilistisches Markenzeichen, aber sie tragen die Handschrift der Körper seiner Schauspieler, ihres körperbetonten Spiels. Vorbilder, die seine Arbeit als Regisseur beeinflusst haben, sind vor allem die ungestümen Energien und der Formenreichtum der Aufführungen von Ariane Mnouchkine und des Tanztheaters von Alain Platel. Und prägend war die Begegnung mit Peter Zadek in einem Theaterregieseminar während Köhlers Ausbildung. Wie wichtig sie für ihn war, hielt er 2003 in einem Bericht fest: „Genau dieser konzentrierte Raum, die sensible Atmosphäre dieser Tage sind die entscheidenden Dinge, die ich aus diesen drei Wochen für meine Arbeit mitgenommen habe. Eine Konzentration, die es ermöglichte, eine große Nähe zu den Schauspielern aufzubauen. Auf die Suche zu gehen nach den Besonderheiten jedes einzelnen Spielers. Eine Nähe zu Tschechow zu entdecken. In den faszinierenden Kosmos der Figuren des ‚Kirschgartens‘ einzutauchen, die so viel Freiheit zu geben scheinen und trotzdem nur einen möglichen Weg zulassen, ihre Geschichte zu erzählen. Und letztendlich eine Begegnung mit dem Motor dieser ganzen Veranstaltung zu haben – Peter Zadek. Ich erlebte einmal, wie er mit der Schauspielerin arbeitete, die die junge Tochter im ‚Kirschgarten‘ spielte. Es ging nur um einen Blick, wenn sie den Firs ansieht, und Peter Zadek meinte zu ihr, dass sie sogar weinen könnte, wenn sie diesen alten Mann sieht. Dann sagte er ihr, dass das nicht jetzt passieren muss, auch nicht in den nächsten zwei Tagen. Im nächsten Durchlauf weinte sie, und es entstand ein ganz wertvoller Moment, völlig frei von dem Druck, etwas produzieren zu müssen. Für mich war das eine der fundamentalsten Erkenntnisse dieser Werkstatt: dass die Kunst der Regie viel weniger in dem liegt, was man sagt, als in dem, wann man einem Schauspieler etwas mitgibt, wann man eine Szene unterbricht. Diese Ehrfurcht vor dem Schaffensprozess des Schauspielers, vor der Fantasie des Einzelnen und der Suche nach den Eigenheiten sind Gedanken, die mich seither begleiten, und sie haben Maßstäbe gesetzt für das Theater, das ich machen will.“
Was Tilmann Köhler über seine Theatervorstellungen notiert hat, finde ich in seinen Inszenierungen schönstens beherzigt und weiterentwickelt. Seine nächste Dresdner Regiearbeit ist nun Tschechows Komödie „Der Kirschgarten“.
Der Theaterhistoriker, Dramaturg und Publizist Klaus Völker war von 1993 bis 2005 Rektor der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Seit 2007 ist er Juror des Förderpreises für junge Regisseure der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.
Tilmann Köhlers Inszenierungen haben kein stilistisches Markenzeichen, aber sie tragen die Handschrift der Körper seiner Schauspieler, ihres körperbetonten Spiels. Vorbilder, die seine Arbeit als Regisseur beeinflusst haben, sind vor allem die ungestümen Energien und der Formenreichtum der Aufführungen von Ariane Mnouchkine und des Tanztheaters von Alain Platel. Und prägend war die Begegnung mit Peter Zadek in einem Theaterregieseminar während Köhlers Ausbildung. Wie wichtig sie für ihn war, hielt er 2003 in einem Bericht fest: „Genau dieser konzentrierte Raum, die sensible Atmosphäre dieser Tage sind die entscheidenden Dinge, die ich aus diesen drei Wochen für meine Arbeit mitgenommen habe. Eine Konzentration, die es ermöglichte, eine große Nähe zu den Schauspielern aufzubauen. Auf die Suche zu gehen nach den Besonderheiten jedes einzelnen Spielers. Eine Nähe zu Tschechow zu entdecken. In den faszinierenden Kosmos der Figuren des ‚Kirschgartens‘ einzutauchen, die so viel Freiheit zu geben scheinen und trotzdem nur einen möglichen Weg zulassen, ihre Geschichte zu erzählen. Und letztendlich eine Begegnung mit dem Motor dieser ganzen Veranstaltung zu haben – Peter Zadek. Ich erlebte einmal, wie er mit der Schauspielerin arbeitete, die die junge Tochter im ‚Kirschgarten‘ spielte. Es ging nur um einen Blick, wenn sie den Firs ansieht, und Peter Zadek meinte zu ihr, dass sie sogar weinen könnte, wenn sie diesen alten Mann sieht. Dann sagte er ihr, dass das nicht jetzt passieren muss, auch nicht in den nächsten zwei Tagen. Im nächsten Durchlauf weinte sie, und es entstand ein ganz wertvoller Moment, völlig frei von dem Druck, etwas produzieren zu müssen. Für mich war das eine der fundamentalsten Erkenntnisse dieser Werkstatt: dass die Kunst der Regie viel weniger in dem liegt, was man sagt, als in dem, wann man einem Schauspieler etwas mitgibt, wann man eine Szene unterbricht. Diese Ehrfurcht vor dem Schaffensprozess des Schauspielers, vor der Fantasie des Einzelnen und der Suche nach den Eigenheiten sind Gedanken, die mich seither begleiten, und sie haben Maßstäbe gesetzt für das Theater, das ich machen will.“
Was Tilmann Köhler über seine Theatervorstellungen notiert hat, finde ich in seinen Inszenierungen schönstens beherzigt und weiterentwickelt. Seine nächste Dresdner Regiearbeit ist nun Tschechows Komödie „Der Kirschgarten“.
Der Theaterhistoriker, Dramaturg und Publizist Klaus Völker war von 1993 bis 2005 Rektor der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Seit 2007 ist er Juror des Förderpreises für junge Regisseure der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.