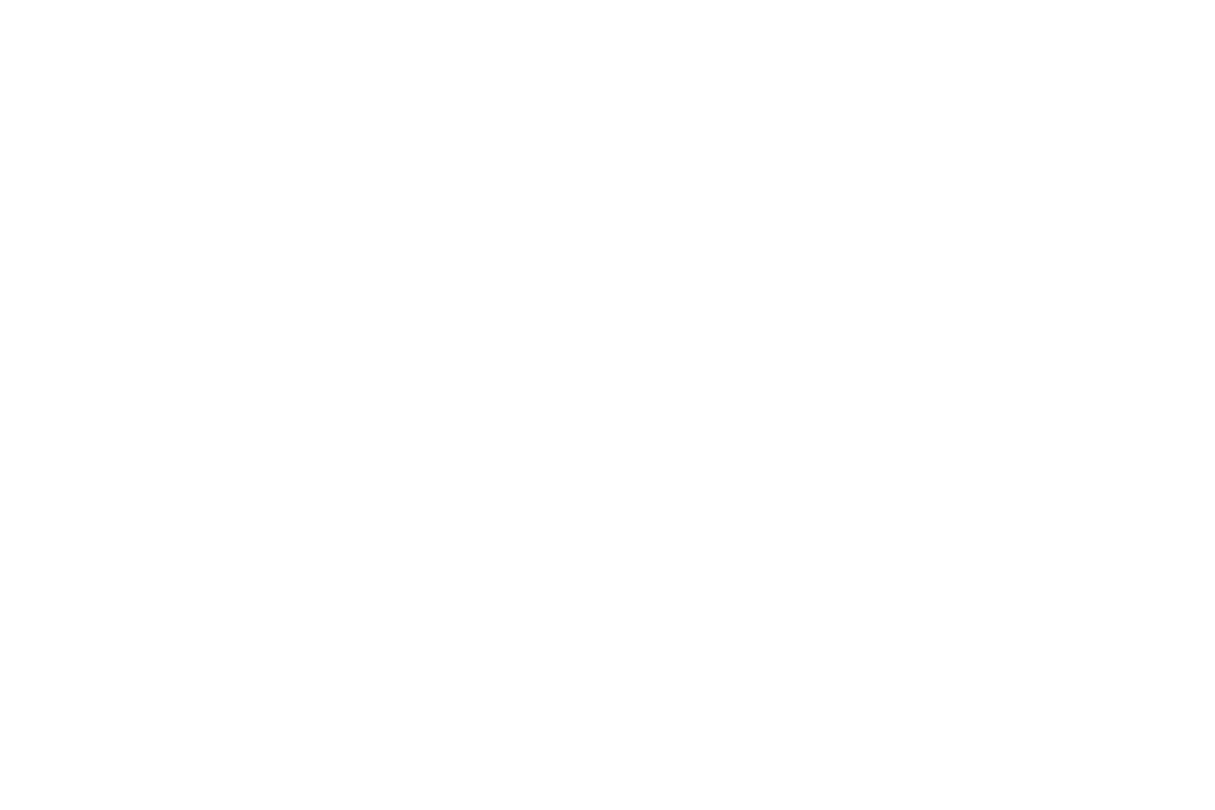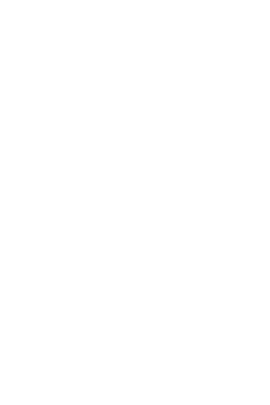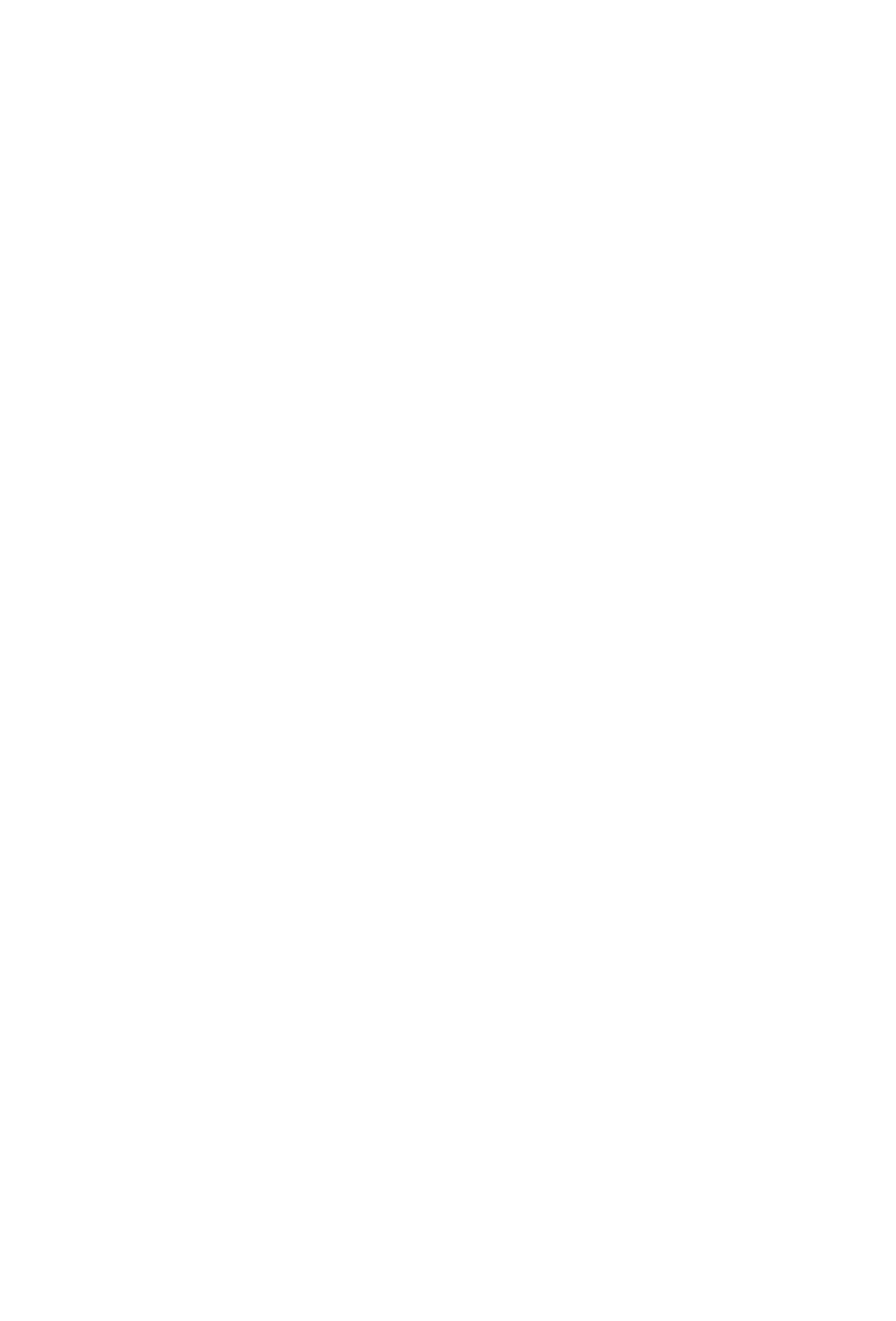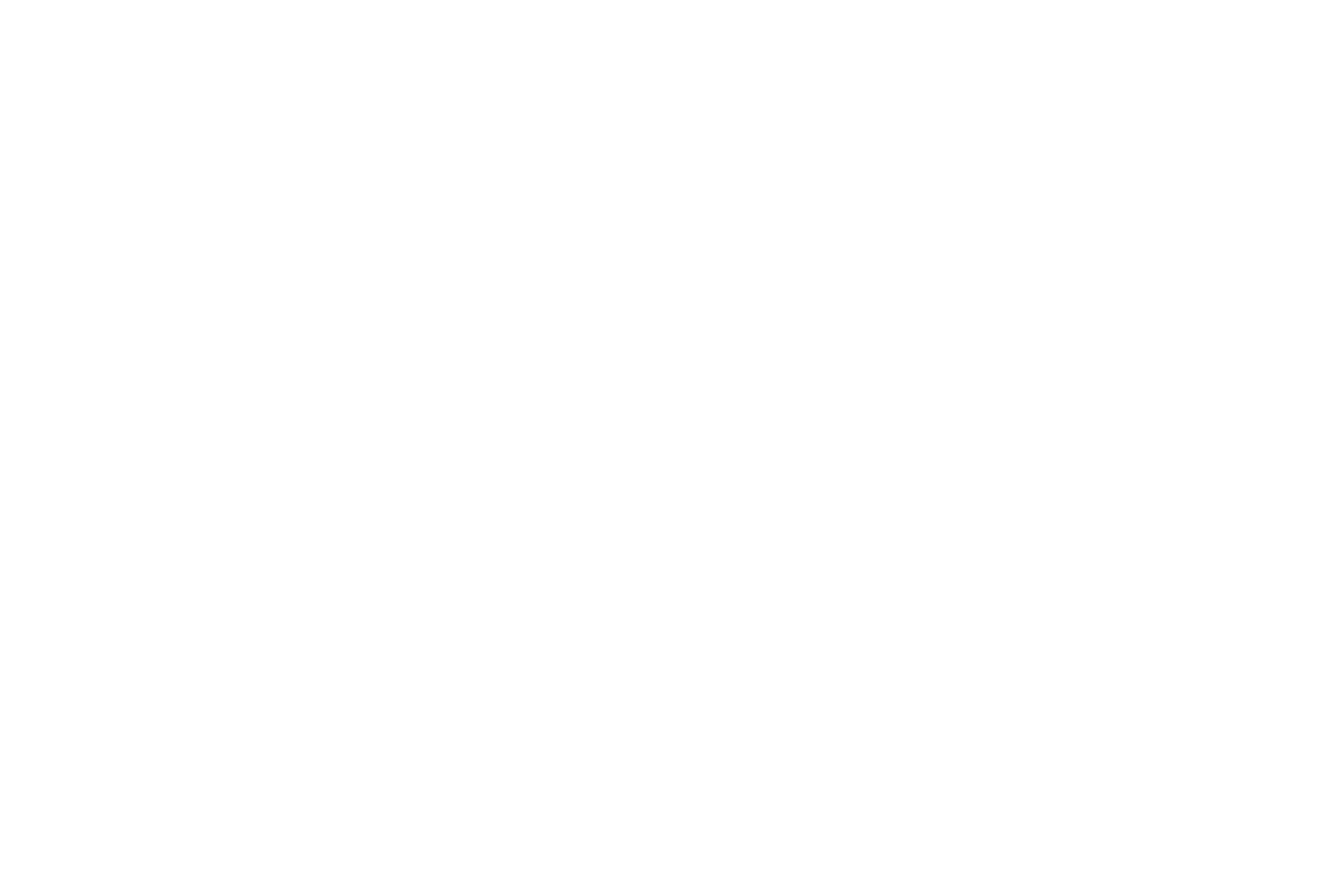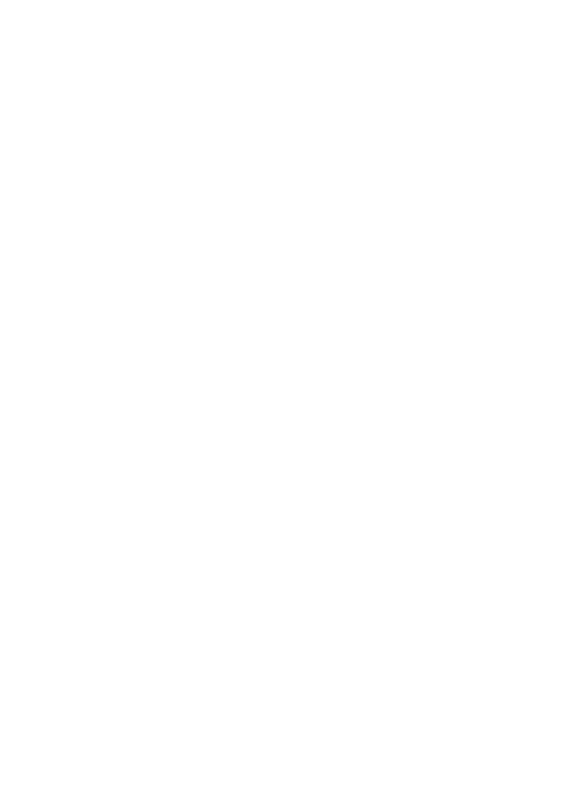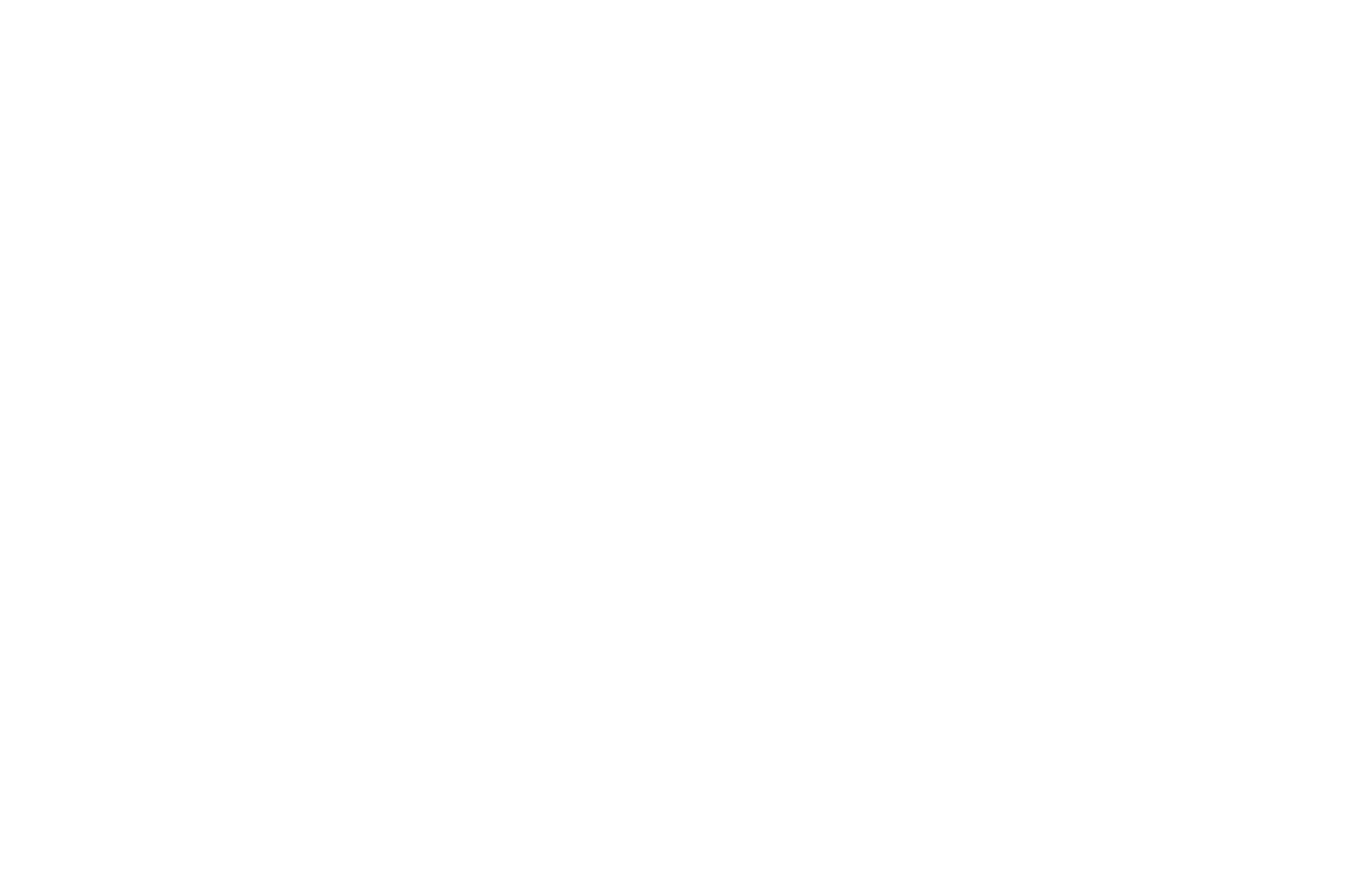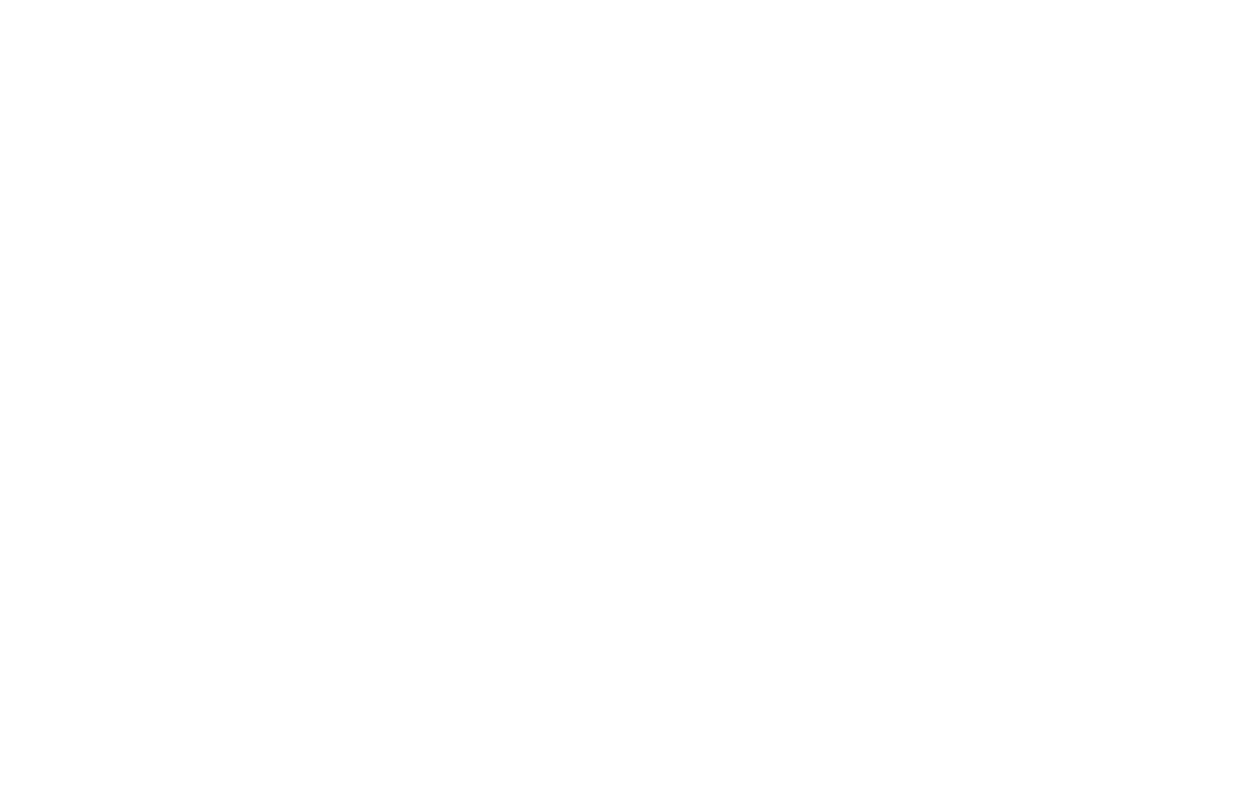Uraufführung 15.02.2013
› Kleines Haus 2
KapiTal der Puppen
von René Pollesch
Handlung
René Pollesch ist einer der wichtigsten deutschen Gegenwartsdramatiker. Zweimal wurde ihm bereits der Mülheimer Theaterpreis (2001 und 2006) und einmal der Wiener Nestroy-Preis (2007) verliehen. Der Autor, der seine Stücke immer selbst inszeniert, bringt Politik und Pop in eine scharfzüngige und dabei oft amüsante Verbindung.
Pollesch-Texte sind luzide, philosophische Theaterschriften, die insbesondere die Themen Liebe, Geld und Kunstbetrieb im Spätkapitalismus zerlegen. In komplexen Sprachverschachtelungen wird unser derzeitiger desolater gesellschaftlicher Zustand schonungslos unter die Lupe genommen. Aus einem Potpourri spaßiger Trivialität und vielschichtigen Theoriekonstrukten geht Pollesch auf die Spurensuche nach falschen und wahren Empfindungen in unserer Gegenwart. Er setzt dabei mit seinen Turbo-Hochbeschleunigungs-Sprach-Suaden auf die Wucht der Unmittelbarkeit, er zelebriert die Sprache auf seine sehr eigene Weise. Bei Pollesch gibt es keine Theaterfiguren; seine Schauspieler sind vielmehr Denk- und Sprachmaschinen, die in Höchstgeschwindigkeit über unser nervöses Zeitalter reflektieren – radikaler und stimmiger lässt sich die Unstimmigkeit unserer Welt vielleicht gar nicht fassen. Pollesch inszeniert seine Texte regelmäßig an der Berliner Volksbühne, wo er neben Frank Castorf entscheidend das künstlerische Profil des Hauses prägt. Er arbeitet außerdem an zahlreichen anderen namhaften Theatern im deutschsprachigen Raum wie z. B. am Thalia Theater Hamburg, am Burgtheater Wien und am Schauspielhaus Zürich.
Pollesch-Texte entstehen unmittelbar in der gemeinsamen Arbeit mit dem Ensemble. Neben kunst-philosophischen Materialsammlungen dient häufig auch ein Film als Folie, diesmal „Das Tal der Puppen“ von Mark Robson aus dem Jahre 1967. In diesem Film geht es um die Schattenseiten des Showbusiness und den Kampf dreier Frauen zwischen Glamour, Sex und Drogen.
Pollesch-Texte sind luzide, philosophische Theaterschriften, die insbesondere die Themen Liebe, Geld und Kunstbetrieb im Spätkapitalismus zerlegen. In komplexen Sprachverschachtelungen wird unser derzeitiger desolater gesellschaftlicher Zustand schonungslos unter die Lupe genommen. Aus einem Potpourri spaßiger Trivialität und vielschichtigen Theoriekonstrukten geht Pollesch auf die Spurensuche nach falschen und wahren Empfindungen in unserer Gegenwart. Er setzt dabei mit seinen Turbo-Hochbeschleunigungs-Sprach-Suaden auf die Wucht der Unmittelbarkeit, er zelebriert die Sprache auf seine sehr eigene Weise. Bei Pollesch gibt es keine Theaterfiguren; seine Schauspieler sind vielmehr Denk- und Sprachmaschinen, die in Höchstgeschwindigkeit über unser nervöses Zeitalter reflektieren – radikaler und stimmiger lässt sich die Unstimmigkeit unserer Welt vielleicht gar nicht fassen. Pollesch inszeniert seine Texte regelmäßig an der Berliner Volksbühne, wo er neben Frank Castorf entscheidend das künstlerische Profil des Hauses prägt. Er arbeitet außerdem an zahlreichen anderen namhaften Theatern im deutschsprachigen Raum wie z. B. am Thalia Theater Hamburg, am Burgtheater Wien und am Schauspielhaus Zürich.
Pollesch-Texte entstehen unmittelbar in der gemeinsamen Arbeit mit dem Ensemble. Neben kunst-philosophischen Materialsammlungen dient häufig auch ein Film als Folie, diesmal „Das Tal der Puppen“ von Mark Robson aus dem Jahre 1967. In diesem Film geht es um die Schattenseiten des Showbusiness und den Kampf dreier Frauen zwischen Glamour, Sex und Drogen.
Besetzung
Regie
René Pollesch
Bühne und Kostüme
Janina Audick
Video
Ute Schall
Licht
Dramaturgie
Julia Weinreich
Mit
sowie
Clemens Bülow, Matthias Günther, Andreas Christoph Meyer, Jakob Ripp, Luise Vollprecht
Video
Ein Gespräch
Ein Gespräch mit dem Autor und Regisseur René Pollesch über die Entstehung seiner Stücke
Man weiß nach zehn Jahren starker öffentlicher Wahrnehmung Ihrer Theaterarbeit relativ viel über Sie als Regisseur oder als Gesamtverantwortlicher Ihrer Abende. Weniger weiß man über Sie als „Nur-Autor“. Wie sind Sie, wenn wir nicht dabei sind? Wenn Sie allein schreiben? Denken Sie als Autor die Bühnensituation und die Schauspieler immer schon mit? Schreiben Sie auch, ohne den Regisseur zu beliefern?
René Pollesch: Das ist unterschiedlich. Ich schreibe ja schon, bevor ich bei der ersten Probe antanze. Da schreibe ich ohne die Schauspieler im Kopf, die ich oft auch noch nicht wirklich kenne, und versuche, erst einmal ein Thema zu installieren.
Dann suchen Sie ein gemeinsames Leseerlebnis auf der Probe …
Ja, da können die Schauspieler ihre Bedürfnisse zu diesem vorgeschlagenen Text äußern. Die Schauspieler bringen eigene Beispiele ein, damit man das Theoretische, das im Text ja erst einmal sehr unkonkret erscheint, versteht und konkret machen kann. Darum bemühe ich mich dann wiederum auch als Autor, wenn ich zwischen den Proben weiterschreibe und ändere: konkrete Geschichten zu erzählen, kleine Geschichten, die als Beispiele für die theoretischen Texte dienen könnten. Ich reagiere tatsächlich erst einmal darauf, was auf den Proben passiert, und versuche herauszufinden, ob ein Gedanke überhaupt eine Chance hat und interessant sein könnte.
Man könnte ja theoretisch auch direkt auf der Probe reagieren und dort schreiben, aber Sie schreiben ja literarische Texte, übernehmen Vorlagen nicht wortwörtlich, sondern überschreiben, kommentieren, brechen sie …
Ich versuche, eine Theorie, die ich gut finde und die mir helfen kann, in meinen Alltag reinzuschreiben. Entsprechend dem Vorschlag Donna Haraways, ihre philosophischen Texte als „Sehhilfen für die Wirklichkeit“ zu verstehen, oder Michel Foucaults Idee, seine Texte als Operationsmesser zu nutzen, die nach Gebrauch zerfallen wie Feuerwerkskörper. Das versuche ich zu realisieren. Deshalb wehre ich mich auch gegen den Begriff der Literatur. Es geht nämlich nicht darum, etwas zu produzieren, das bleibt und immer wieder aktualisiert werden kann, sondern darum, etwas zu erzeugen, das man benutzen kann. Haraways und Foucaults Texte kann ich aber in der Form, in der sie sind, für das Theater nicht benutzen. Und da ich nun mal Theatermensch bin und Theater machen will und nicht Vorlesungen kuratieren, möchte ich eben das Verwickeltsein der Schauspielerkörper in das Thema zeigen. Im Theater müssen wir uns um das kümmern, was in unserer Nähe ist. Denn alles andere ist nur Spekulation.
Spielen Sie als Autor mit Ihrer Technik, Themen zu setzen und zu verschneiden, nicht auch vorsätzlich mit den Erwartungshaltungen von Zuschauern? Die theoretischen Texte werden ja immer wieder durch boulevardeske Aktionen gebrochen und umgekehrt.
Das ist vor allem für die Schauspieler wichtig. Dieses ständige Abbrechen und Springen hält die Schauspieler von einer Komplettierung ab, es hält uns die Situation vom Hintern weg.
Als Autor vermeiden Sie dadurch auch ein Zuviel an Bedeutung. Ist das der Grund für das radikale Hakenschlagen in Ihren Texten?
Das kann sein. Wir wollen die Leute nicht unterweisen, nicht autoritär sein. Die Texte sollen auch nicht hierarchisiert oder orchestriert werden oder zu meiner Interpretation werden.
René Pollesch: Das ist unterschiedlich. Ich schreibe ja schon, bevor ich bei der ersten Probe antanze. Da schreibe ich ohne die Schauspieler im Kopf, die ich oft auch noch nicht wirklich kenne, und versuche, erst einmal ein Thema zu installieren.
Dann suchen Sie ein gemeinsames Leseerlebnis auf der Probe …
Ja, da können die Schauspieler ihre Bedürfnisse zu diesem vorgeschlagenen Text äußern. Die Schauspieler bringen eigene Beispiele ein, damit man das Theoretische, das im Text ja erst einmal sehr unkonkret erscheint, versteht und konkret machen kann. Darum bemühe ich mich dann wiederum auch als Autor, wenn ich zwischen den Proben weiterschreibe und ändere: konkrete Geschichten zu erzählen, kleine Geschichten, die als Beispiele für die theoretischen Texte dienen könnten. Ich reagiere tatsächlich erst einmal darauf, was auf den Proben passiert, und versuche herauszufinden, ob ein Gedanke überhaupt eine Chance hat und interessant sein könnte.
Man könnte ja theoretisch auch direkt auf der Probe reagieren und dort schreiben, aber Sie schreiben ja literarische Texte, übernehmen Vorlagen nicht wortwörtlich, sondern überschreiben, kommentieren, brechen sie …
Ich versuche, eine Theorie, die ich gut finde und die mir helfen kann, in meinen Alltag reinzuschreiben. Entsprechend dem Vorschlag Donna Haraways, ihre philosophischen Texte als „Sehhilfen für die Wirklichkeit“ zu verstehen, oder Michel Foucaults Idee, seine Texte als Operationsmesser zu nutzen, die nach Gebrauch zerfallen wie Feuerwerkskörper. Das versuche ich zu realisieren. Deshalb wehre ich mich auch gegen den Begriff der Literatur. Es geht nämlich nicht darum, etwas zu produzieren, das bleibt und immer wieder aktualisiert werden kann, sondern darum, etwas zu erzeugen, das man benutzen kann. Haraways und Foucaults Texte kann ich aber in der Form, in der sie sind, für das Theater nicht benutzen. Und da ich nun mal Theatermensch bin und Theater machen will und nicht Vorlesungen kuratieren, möchte ich eben das Verwickeltsein der Schauspielerkörper in das Thema zeigen. Im Theater müssen wir uns um das kümmern, was in unserer Nähe ist. Denn alles andere ist nur Spekulation.
Spielen Sie als Autor mit Ihrer Technik, Themen zu setzen und zu verschneiden, nicht auch vorsätzlich mit den Erwartungshaltungen von Zuschauern? Die theoretischen Texte werden ja immer wieder durch boulevardeske Aktionen gebrochen und umgekehrt.
Das ist vor allem für die Schauspieler wichtig. Dieses ständige Abbrechen und Springen hält die Schauspieler von einer Komplettierung ab, es hält uns die Situation vom Hintern weg.
Als Autor vermeiden Sie dadurch auch ein Zuviel an Bedeutung. Ist das der Grund für das radikale Hakenschlagen in Ihren Texten?
Das kann sein. Wir wollen die Leute nicht unterweisen, nicht autoritär sein. Die Texte sollen auch nicht hierarchisiert oder orchestriert werden oder zu meiner Interpretation werden.
Das Unterlaufen der Bedeutung zielt also auf einen gewollten Verlust von Autorität?
Ja genau, ich will mich auch von der Autorität distanzieren, die mit einem bestimmten Literaturbegriff einhergeht. Diese Distanzierung nicht zu wagen war jedenfalls lange mein Problem. Ich habe sehr früh angefangen zu schreiben, aber eigentlich habe ich 20 Jahre geschrieben, ohne zu schreiben. Ich bin 20 Jahre lang einer bestimmten Vorstellung davon, was Literatur ist, hinterhergerannt, habe meine Sachen zum Verlag geschickt und beurteilen lassen. Dieser autoritäre Literaturbegriff, der am Theater als Primat installiert ist, war ja auch immer schon ein Thema, das wollten schon viele loswerden: Weg mit den Meisterwerken, nutzen wir die Gegenwart!
Geht es bei diesem Autoritätsabbau auch um das Verschwinden des Autors? Wollen Sie als Autorensubjekt vielleicht gar nicht erkannt werden?
Wenn ich nur schreiben würde, wäre ich in Gefahr, mich dafür zu interessieren, was ich da eigentlich mache. Aber ich interessiere mich nur für die geeigneten Instrumente und dafür, dass man den Text an dem Abend hört. Ich entlaste mich quasi dadurch, dass ich gleichzeitig auch als Regisseur unterwegs sein kann. Das ist vielleicht der eigentliche Trick bei diesem Autor-und-Regisseur-gleichzeitig-Sein, dass man immer entwischen kann. Wenn man mich als Regisseur anspricht, sage ich, nein, ich schreibe, und wenn man mich als Autor anspricht, sage ich, nein, ich bin Regisseur. Das ist wie eine Art Reflex. Vielleicht ist es eben etwas Drittes, was man da macht.
Ist Schreiben denn nicht eine Abfolge von Einzelentscheidungen?
Natürlich werden dauernd Entscheidungen getroffen, aber die sind nicht pro Literatur, sondern sie sind vor allem politischer Natur, weil sie immer die Praxis betreffen. Ich will als Regisseur auch nichts Bestimmtes sehen, sondern ich möchte, dass die Schauspieler ins Spielen kommen, um sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Oder man kehrt wieder auf die Stühle zurück, wenn einem nichts einfällt. Ich werde niemals einen Schauspieler zwingen, etwas zu üben, bis es gelingt, nur weil ich denke, es muss gelingen. Regisseure müssen sich immer legitimieren, warum sie in ihrer Position sind, und haben Angst vor jedem Einfall der Schauspieler. Davon bin ich relativ befreit.
Sie haben nur Angst vor Regisseuren, die Ihre Texte inszenieren wollen …
(Lacht) Ich muss dann mal los.
René Pollesch arbeitet als Autor und Regisseur und wurde vielfach für seine Texte und Inszenierungen ausgezeichnet. „Kapi Tal der Puppen“ ist seine erste Arbeit am Staatsschauspiel Dresden.
Der vorliegende Text ist ein Auszug aus einem Gespräch, das der Dramaturg Roland Koberg mit René Pollesch in Zürich geführt hat.
Ja genau, ich will mich auch von der Autorität distanzieren, die mit einem bestimmten Literaturbegriff einhergeht. Diese Distanzierung nicht zu wagen war jedenfalls lange mein Problem. Ich habe sehr früh angefangen zu schreiben, aber eigentlich habe ich 20 Jahre geschrieben, ohne zu schreiben. Ich bin 20 Jahre lang einer bestimmten Vorstellung davon, was Literatur ist, hinterhergerannt, habe meine Sachen zum Verlag geschickt und beurteilen lassen. Dieser autoritäre Literaturbegriff, der am Theater als Primat installiert ist, war ja auch immer schon ein Thema, das wollten schon viele loswerden: Weg mit den Meisterwerken, nutzen wir die Gegenwart!
Geht es bei diesem Autoritätsabbau auch um das Verschwinden des Autors? Wollen Sie als Autorensubjekt vielleicht gar nicht erkannt werden?
Wenn ich nur schreiben würde, wäre ich in Gefahr, mich dafür zu interessieren, was ich da eigentlich mache. Aber ich interessiere mich nur für die geeigneten Instrumente und dafür, dass man den Text an dem Abend hört. Ich entlaste mich quasi dadurch, dass ich gleichzeitig auch als Regisseur unterwegs sein kann. Das ist vielleicht der eigentliche Trick bei diesem Autor-und-Regisseur-gleichzeitig-Sein, dass man immer entwischen kann. Wenn man mich als Regisseur anspricht, sage ich, nein, ich schreibe, und wenn man mich als Autor anspricht, sage ich, nein, ich bin Regisseur. Das ist wie eine Art Reflex. Vielleicht ist es eben etwas Drittes, was man da macht.
Ist Schreiben denn nicht eine Abfolge von Einzelentscheidungen?
Natürlich werden dauernd Entscheidungen getroffen, aber die sind nicht pro Literatur, sondern sie sind vor allem politischer Natur, weil sie immer die Praxis betreffen. Ich will als Regisseur auch nichts Bestimmtes sehen, sondern ich möchte, dass die Schauspieler ins Spielen kommen, um sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Oder man kehrt wieder auf die Stühle zurück, wenn einem nichts einfällt. Ich werde niemals einen Schauspieler zwingen, etwas zu üben, bis es gelingt, nur weil ich denke, es muss gelingen. Regisseure müssen sich immer legitimieren, warum sie in ihrer Position sind, und haben Angst vor jedem Einfall der Schauspieler. Davon bin ich relativ befreit.
Sie haben nur Angst vor Regisseuren, die Ihre Texte inszenieren wollen …
(Lacht) Ich muss dann mal los.
René Pollesch arbeitet als Autor und Regisseur und wurde vielfach für seine Texte und Inszenierungen ausgezeichnet. „Kapi Tal der Puppen“ ist seine erste Arbeit am Staatsschauspiel Dresden.
Der vorliegende Text ist ein Auszug aus einem Gespräch, das der Dramaturg Roland Koberg mit René Pollesch in Zürich geführt hat.