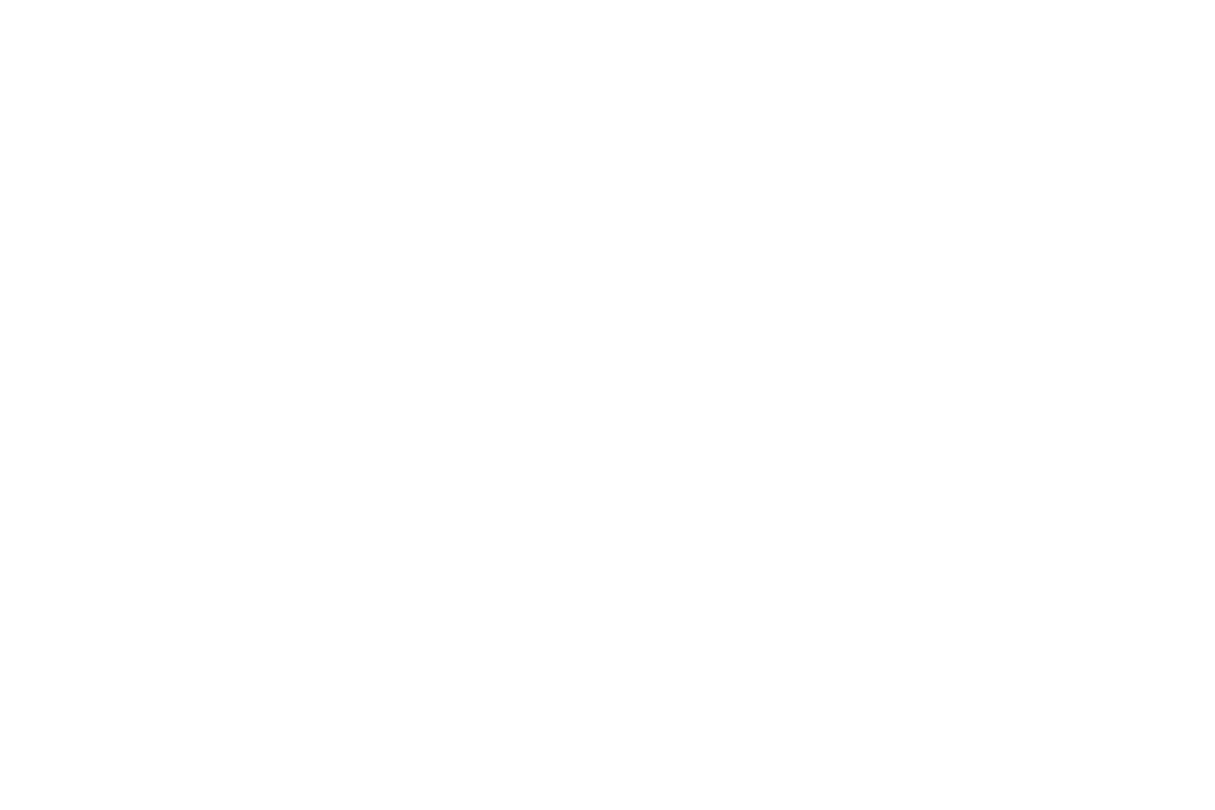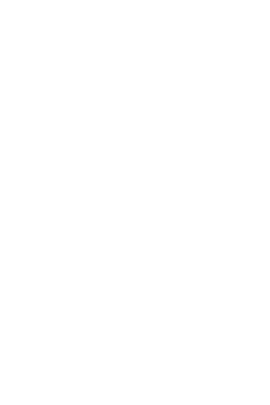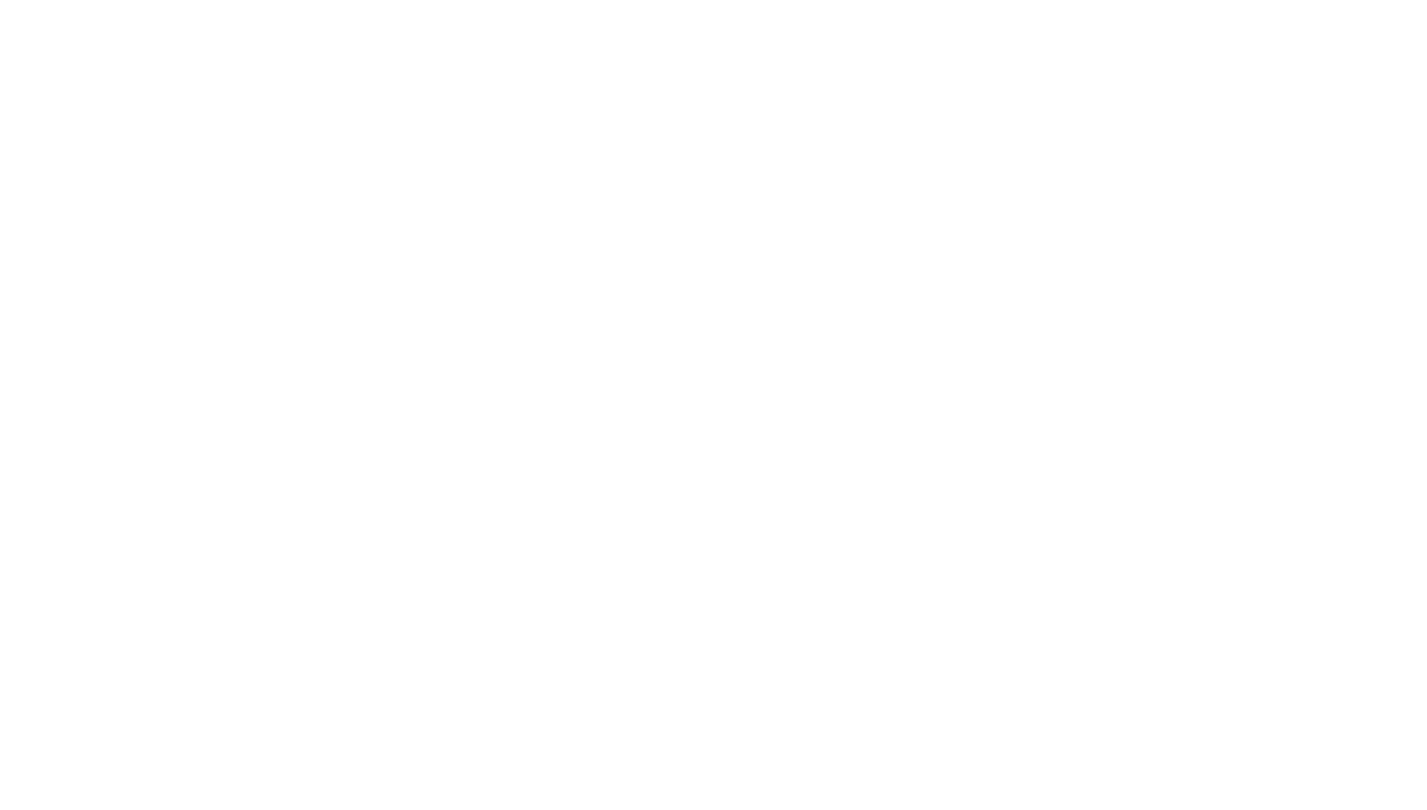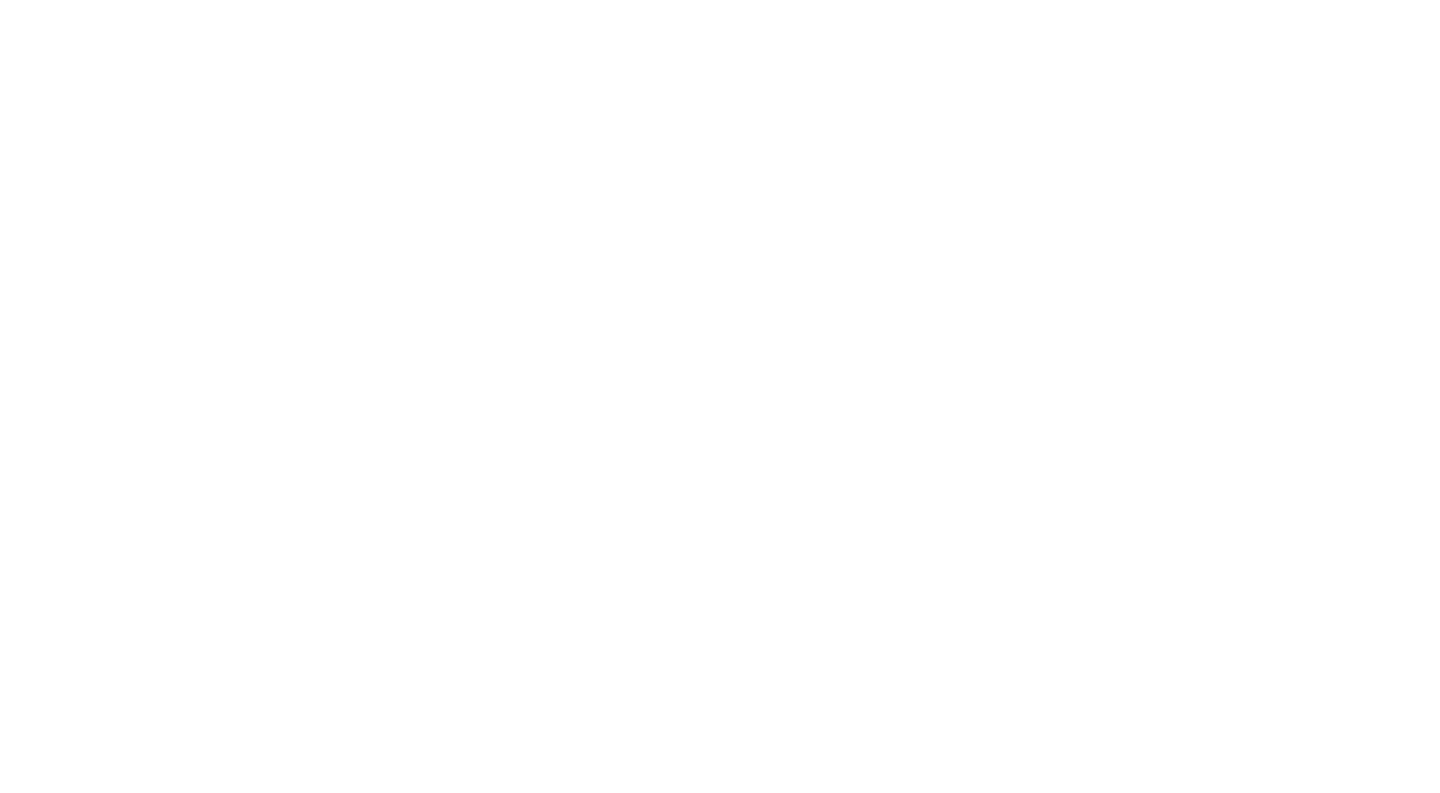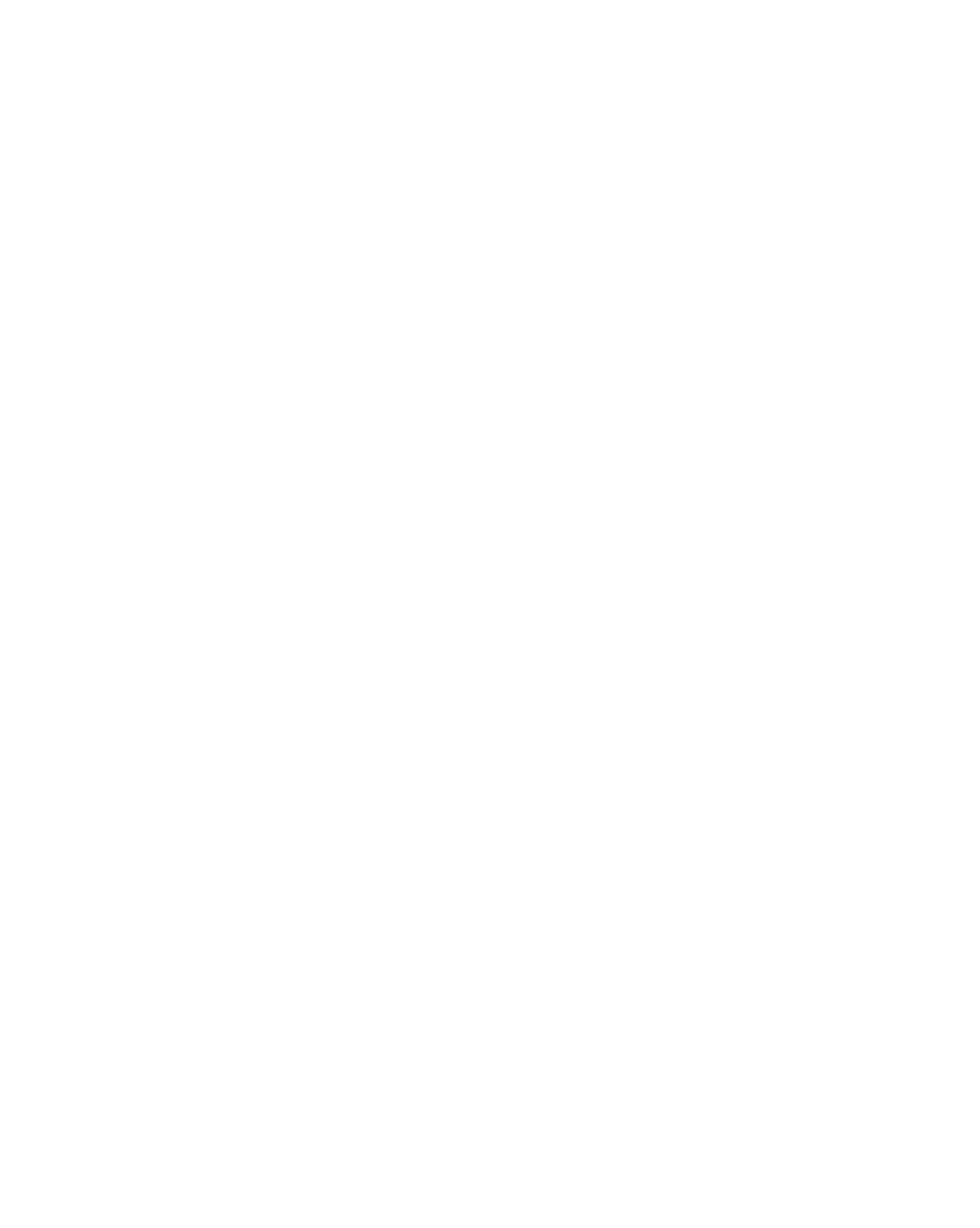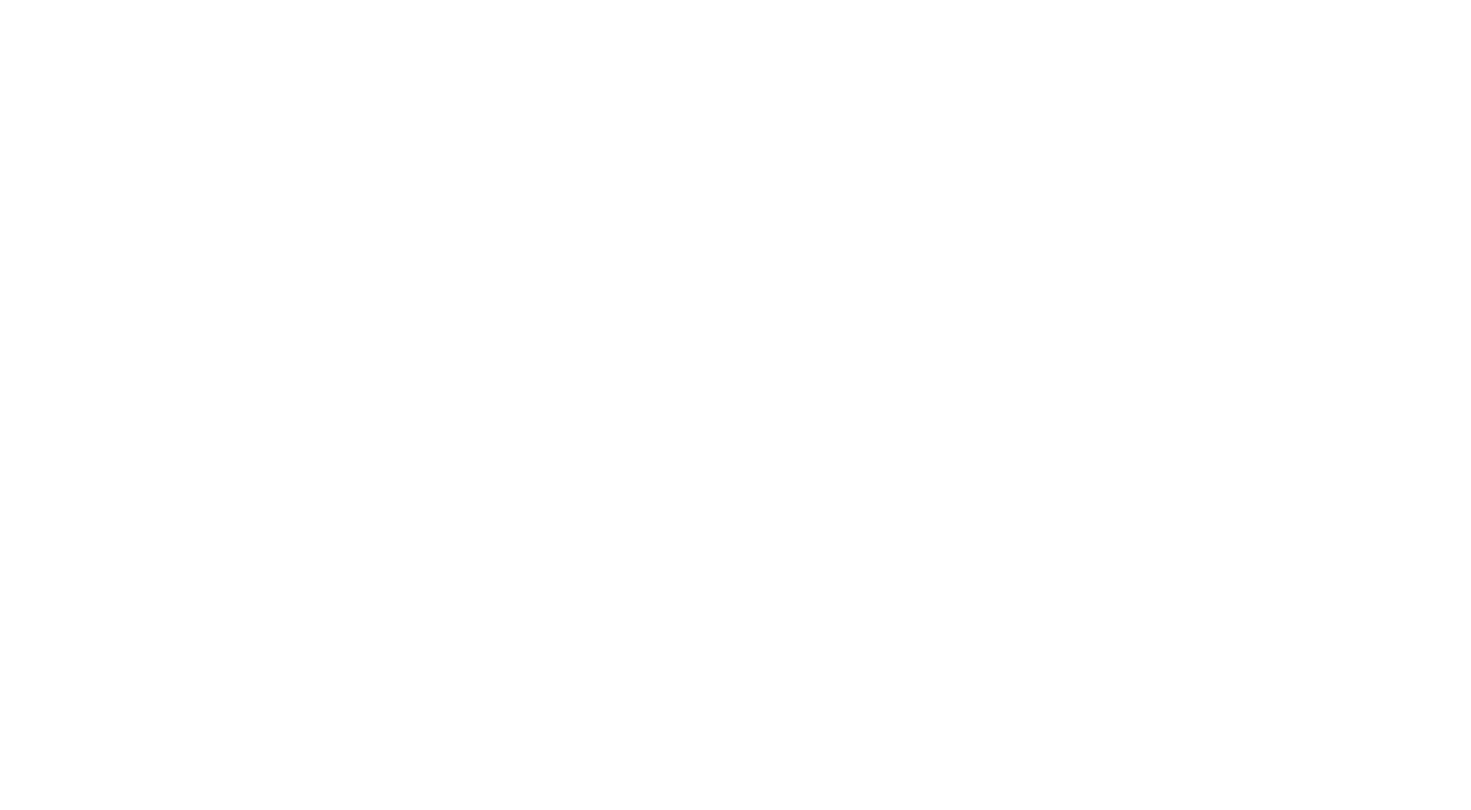Premiere 28.05.2011
› Schauspielhaus
Rheingold
Musiktheater nach Richard Wagner
Handlung
„Rheingold“ ist ein Spiel um Verführung. Durch schöne Frauen, durch Reichtum, durch Macht – und vor allem durch die Musik. Wie durch die Wohnzimmerfenster Walhalls sehen wir in Wagners Welt: Im Untergeschoss schmiedet der hässliche Zwerg Alberich übelwollend einen Ring, während im Hof unschuldig die Rheintöchter spielen; im ersten Stock streiten Freia und Fricka mit Wotan der unvermeidlichen Götterdämmerung entgegen, während nebenan der Ortsverein irgendeiner Wagnergesellschaft tagt und ewig fragt: Wer darf Wagner dirigieren? Der Regisseur David Marton untersucht den Mythos Wagner, seine Faszination und die Macht der Musik. Mit von der Partie sind Schauspieler und dezidierte Nicht-Wagner-Sänger – eine Jazz-Sängerin und ein lyrischer Tenor – und statt einem großen Orchester nur zwei Musiker: der Pianist Jan Czajkowski und der Cellist und Improvisator Martin Schütz. David Marton lotet in seinen Inszenierungen den Grenzbereich zwischen Musiktheater und Schauspiel aus. Am Wiener Burgtheater musikalisierte er Peter Esterhazys Familienepos „Harmonia Caelestis“, in „Lulu“ nach Alban Berg / Frank Wedekind verdreifachte er die Titelrolle und versetzte die Geschichte in ein Tonstudio. „Lulu“ wurde zur Musiktheater-Inszenierung des Jahres 2009 gewählt.
Besetzung
Regie
David Marton
Musikalische Leitung
Jan Czajkowski, Christoph Homberger, Martin Schütz
Bühne und Kostüme
Alissa Kolbusch
Dramaturgie
Felicitas Zürcher
Licht
Michael Gööck
Wellgunde
Cathleen Baumann
Klavier
Jan Czajkowski
Freia
Mila Dargies
Fricka
Olivia Grigolli
Fasolt
Stefko Hanushevsky
Dirigent
Christoph Homberger
Wotan
Max Hopp
Alberich
Benjamin Höppner
Loge
Yelena Kuljic
Fafner
Wolfgang Michalek
Cello / Live-Elektronik
Martin Schütz
Flosshilde
Yuka Yanagihara
Video
Porträt
Der Theater- und Opernregisseur David Marton
von Boris Michael Gruhl
von Boris Michael Gruhl
Kann es einen Ort geben, an dem man Auswirkungen von Begegnungen, Überlappungen und Unvereinbarkeiten mit sich gegenseitig abstoßender und zugleich anziehender Wirkung zwischen Ost und West stärker wahrnehmen kann als in Berlin? David Marton kam 1996 aus Ungarn nach Berlin, wo er inzwischen wohnt und wo wir uns in einer Kreuzberger Osteria treffen. In Budapest geboren, aufgewachsen und zum Pianisten und Dirigenten ausgebildet, schließt er seine Studien an der hiesigen Universität der Künste ab. Gleichzeitig, so der Eindruck im Gespräch, wagt er nach längst virulentem Unbehagen an der dort wie da erfahrenen Praxis des normierten und immer stärker marktorientierten Musiklebens erste so mutige wie risikobereite Schritte auf einem Weg der Erkundung menschlicher Musikalität, die es hinter den daraus erwachsenen Kunstformen zu finden gilt.
Bestimmt von der Wahrnehmung und Annahme eigener Bindungen und Unfreiheit beginnt für den jungen Musiker im Ausprobieren künstlerischer Symbiosen aus Klängen, Sprache und Bildwelten das Experiment der partiellen Erfahrung von Freiheit. David Marton fängt an, als Regisseur zu arbeiten. Zusammen mit anderen von Musik, Sprache und dem Bild bewegten Visionären macht er mit Projekten auf sich aufmerksam, in denen er sich auf der Grundlage ziemlich bekannter Opernstoffe wie „Der Freischütz“, „Don Giovanni“, „Wozzeck“ oder „Lulu“ so authentisch wie angreifbar in das Chaos ungelöster Fragen unserer vom Scheitern bestimmten Existenz stürzt.
Diese Arbeiten sind weit entfernt von den inzwischen oftmals zum Klischee erstarrten Versatzteilen des sogenannten Regietheaters, dessen Ausübung sich bestens eingefügt hat in den so globalen wie austauschbaren Opernbetrieb. Marton verwehrt sich zu Recht, würde man davon sprechen, dass er eine Methode habe oder ein System. Die Kraft seiner Arbeiten beruht eher darin, dass sie im Moment der Mitteilung dessen, was das ganze Team im Verlauf der Erarbeitung an Erfahrungen miteinander geteilt hat, die Lebendigkeit eines so kostbaren Vorgangs nicht verloren haben. Weil solche Arbeits- und Aufführungspraktiken dem derzeitigen Opernbetrieb diametral entgegenstehen, arbeitet David Marton vornehmlich an Schauspielhäusern. Er führt Schauspieler und Musiker zusammen und mischt die Möglichkeiten des Singens, Sprechens und Musizierens. Im Glücksfall dringt er so bis in jenes Terrain menschlicher Entäußerungen vor, in Situationen der Grenzerfahrung, für die einzig Musik ein Mittel des Ausdrucks ist und die wir dann wahrnehmen können als die „Musik hinter der Musik“, als Klänge, aus denen Kunstformen wie etwa Kompositionen des Musiktheaters entstehen.
So kommt es zu jenem anderen Blick und jenem anderen Klang, die die Inszenierungen des jeweiligen Teams um David Marton ausmachen. Dabei spielen Kategorien wie „richtig“ oder „falsch“ keine entscheidende Rolle, es kann nicht um ein Monopol der Deutungshoheit gehen, wenn die Kreativität des Irrtums und des Scheiterns den Weg der Erkundung begleitet. Die Maßstäbe solcher Arbeit sind Interesse und Liebe sowie die daraus erwachsende Authentizität im Umgang mit Menschen, Künsten und deren Geschichten.
Vielleicht hat ein Mensch wie David Marton mit so wachem Gespür für die Prägungen, die er zunächst als Kind und Jugendlicher im einigermaßen abgeschotteten Ungarn und dessen sozialistischer Ausrichtung erfuhr, die jäh abgelöst wurden durch Umbrüche, die im Namen der Freiheit schlimmste Verwerfungen mit sich brachten, ein ganz besonderes Interesse daran, was Menschen in ihren Geschichten bestehen oder scheitern lässt. Wahrzunehmen, was Biografien prägt, muss dann nicht zwangsläufig dazu führen, ein Urteil zu fällen oder in der künstlerischen Arbeit dem Publikum Lösungen in platter Aktualisierung zu verabreichen. Wenn überhaupt, dann könnte solches Theater im allerbesten Falle durch Sensibilisierung für die Wahrnehmung jener schmerzhaften Glücksmomente absoluter Schutzlosigkeit der Protagonisten den Zuschauenden geschützte Blicke in den eigenen Abgrund ermöglichen. Und dann – so absurd es scheinen mag – kann beim erneuten Hinsehen die Bühne zum weit geöffneten Fenster am Horizont der Erkenntnis werden.
Bestimmt von der Wahrnehmung und Annahme eigener Bindungen und Unfreiheit beginnt für den jungen Musiker im Ausprobieren künstlerischer Symbiosen aus Klängen, Sprache und Bildwelten das Experiment der partiellen Erfahrung von Freiheit. David Marton fängt an, als Regisseur zu arbeiten. Zusammen mit anderen von Musik, Sprache und dem Bild bewegten Visionären macht er mit Projekten auf sich aufmerksam, in denen er sich auf der Grundlage ziemlich bekannter Opernstoffe wie „Der Freischütz“, „Don Giovanni“, „Wozzeck“ oder „Lulu“ so authentisch wie angreifbar in das Chaos ungelöster Fragen unserer vom Scheitern bestimmten Existenz stürzt.
Diese Arbeiten sind weit entfernt von den inzwischen oftmals zum Klischee erstarrten Versatzteilen des sogenannten Regietheaters, dessen Ausübung sich bestens eingefügt hat in den so globalen wie austauschbaren Opernbetrieb. Marton verwehrt sich zu Recht, würde man davon sprechen, dass er eine Methode habe oder ein System. Die Kraft seiner Arbeiten beruht eher darin, dass sie im Moment der Mitteilung dessen, was das ganze Team im Verlauf der Erarbeitung an Erfahrungen miteinander geteilt hat, die Lebendigkeit eines so kostbaren Vorgangs nicht verloren haben. Weil solche Arbeits- und Aufführungspraktiken dem derzeitigen Opernbetrieb diametral entgegenstehen, arbeitet David Marton vornehmlich an Schauspielhäusern. Er führt Schauspieler und Musiker zusammen und mischt die Möglichkeiten des Singens, Sprechens und Musizierens. Im Glücksfall dringt er so bis in jenes Terrain menschlicher Entäußerungen vor, in Situationen der Grenzerfahrung, für die einzig Musik ein Mittel des Ausdrucks ist und die wir dann wahrnehmen können als die „Musik hinter der Musik“, als Klänge, aus denen Kunstformen wie etwa Kompositionen des Musiktheaters entstehen.
So kommt es zu jenem anderen Blick und jenem anderen Klang, die die Inszenierungen des jeweiligen Teams um David Marton ausmachen. Dabei spielen Kategorien wie „richtig“ oder „falsch“ keine entscheidende Rolle, es kann nicht um ein Monopol der Deutungshoheit gehen, wenn die Kreativität des Irrtums und des Scheiterns den Weg der Erkundung begleitet. Die Maßstäbe solcher Arbeit sind Interesse und Liebe sowie die daraus erwachsende Authentizität im Umgang mit Menschen, Künsten und deren Geschichten.
Vielleicht hat ein Mensch wie David Marton mit so wachem Gespür für die Prägungen, die er zunächst als Kind und Jugendlicher im einigermaßen abgeschotteten Ungarn und dessen sozialistischer Ausrichtung erfuhr, die jäh abgelöst wurden durch Umbrüche, die im Namen der Freiheit schlimmste Verwerfungen mit sich brachten, ein ganz besonderes Interesse daran, was Menschen in ihren Geschichten bestehen oder scheitern lässt. Wahrzunehmen, was Biografien prägt, muss dann nicht zwangsläufig dazu führen, ein Urteil zu fällen oder in der künstlerischen Arbeit dem Publikum Lösungen in platter Aktualisierung zu verabreichen. Wenn überhaupt, dann könnte solches Theater im allerbesten Falle durch Sensibilisierung für die Wahrnehmung jener schmerzhaften Glücksmomente absoluter Schutzlosigkeit der Protagonisten den Zuschauenden geschützte Blicke in den eigenen Abgrund ermöglichen. Und dann – so absurd es scheinen mag – kann beim erneuten Hinsehen die Bühne zum weit geöffneten Fenster am Horizont der Erkenntnis werden.
Es mag eine Frage der Zeit und der Gelegenheit gewesen sein, bis sich für David Marton wieder ein Anlass bot, dem Menschen Richard Wagner, seinem Schaffen, aber vor allem seinen Entwürfen von sich, seinem Werk und seiner Welt zu begegnen. Dazu kommt die erneute Zusammenarbeit mit dem Sänger Christoph Homberger, jenem Ausnahmetenor, mit dem er als musikalischer Leiter in der Inszenierung von Frank Castorf an der Berliner Volksbühne ein Projekt nach Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ realisierte. Zum Berliner „Meistersinger“-Team gehörte auch Jan Czajkowski, Martons langjähriger musikalischer Partner als Pianist und Arrangeur.
Jetzt werden sich Marton, Homberger und Czajkowski in Dresden im Rahmen der Musikfestspiele mit Wagner zum Urgrund dessen begeben, worauf das ganze verräterische, vergebliche und mörderische Welttheater beruht. Es geht, so David Marton, zum Gott über den Göttern, zum Gold mit Glanz und Fluch. Im Schauspielhaus, jenem großen Theater mit menschlichem Maß, wie er sagt, bringt er „Das Rheingold“, das Vorspiel zur Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“, auf die Bühne. Es ist das Vorspiel in Wagners Chronologie einer Unheilsgeschichte, in der erst die Götter, dann die Menschen abtreten. In der gedanklichen Chronologie der Entstehung hingegen steht im Prinzip das Endspiel „Die Götterdämmerung“ am Anfang. Dieses Finale ist aus einer zunächst in Prosa verfassten Arbeit entstanden, die zur Heldenoper in Versen mit dem Titel „Siegfrieds Tod“ hätte werden sollen. Vorausgegangen war die Idee, ein Drama über Barbarossa zu schreiben und eines über Jesus von Nazareth, von dem es Fragmente gibt.
Natürlich ist das Werk Richard Wagners für David Marton von großem Interesse, gehen hier doch wie selten im Musiktheater Wort und Musik eines Autors zusammen, speisen sich die Dramen in ihren Wiederholungen und Endlosschleifen der Vergeblichkeit aus Reflexionen persönlicher und politischer Erfahrungen im Kontext historisch bedingter Gegenwart und daraus abgeleiteter Visionen. Vom Ende her gedacht setzt Wagner dem Drama ein Vorspiel voran, einen Augenblick nur, bevor das Spiel beginnt, allein der Musik ist es vorbehalten, den Anfang von allem mit einem „Wiegenlied der Welt“ zu beginnen, „Mit ruhig heiterer Bewegung. Es-Dur. 6/8“. Was folgt, ist Ruhelosigkeit. Und deren Ton ist auch schon da. In diese Ruhelosigkeit gilt es einzutauchen, mit den Mitteln des Theaters und der Musik wieder und wieder Reibungen und Kontraste zu erzeugen, das Drama hinter der Oper zu entdecken und die Korrespondenz zum eigenen Drama in den Versuchen, der Geschichte wenigstens einen Anfang zu geben, wenn doch ihr Ende schon bestimmt ist.
Was die Arbeit David Martons in Dresden zu Wagners „Das Rheingold“ betrifft, hat aber bereits eine neue Geschichte begonnen.
Boris Michael Gruhl lebt und arbeitet in Dresden als Autor, Kulturjournalist, Herausgeber und Redakteur. Dieser Text ist ein Originalbeitrag für das Spielzeitheft 2010.2011.
Jetzt werden sich Marton, Homberger und Czajkowski in Dresden im Rahmen der Musikfestspiele mit Wagner zum Urgrund dessen begeben, worauf das ganze verräterische, vergebliche und mörderische Welttheater beruht. Es geht, so David Marton, zum Gott über den Göttern, zum Gold mit Glanz und Fluch. Im Schauspielhaus, jenem großen Theater mit menschlichem Maß, wie er sagt, bringt er „Das Rheingold“, das Vorspiel zur Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“, auf die Bühne. Es ist das Vorspiel in Wagners Chronologie einer Unheilsgeschichte, in der erst die Götter, dann die Menschen abtreten. In der gedanklichen Chronologie der Entstehung hingegen steht im Prinzip das Endspiel „Die Götterdämmerung“ am Anfang. Dieses Finale ist aus einer zunächst in Prosa verfassten Arbeit entstanden, die zur Heldenoper in Versen mit dem Titel „Siegfrieds Tod“ hätte werden sollen. Vorausgegangen war die Idee, ein Drama über Barbarossa zu schreiben und eines über Jesus von Nazareth, von dem es Fragmente gibt.
Natürlich ist das Werk Richard Wagners für David Marton von großem Interesse, gehen hier doch wie selten im Musiktheater Wort und Musik eines Autors zusammen, speisen sich die Dramen in ihren Wiederholungen und Endlosschleifen der Vergeblichkeit aus Reflexionen persönlicher und politischer Erfahrungen im Kontext historisch bedingter Gegenwart und daraus abgeleiteter Visionen. Vom Ende her gedacht setzt Wagner dem Drama ein Vorspiel voran, einen Augenblick nur, bevor das Spiel beginnt, allein der Musik ist es vorbehalten, den Anfang von allem mit einem „Wiegenlied der Welt“ zu beginnen, „Mit ruhig heiterer Bewegung. Es-Dur. 6/8“. Was folgt, ist Ruhelosigkeit. Und deren Ton ist auch schon da. In diese Ruhelosigkeit gilt es einzutauchen, mit den Mitteln des Theaters und der Musik wieder und wieder Reibungen und Kontraste zu erzeugen, das Drama hinter der Oper zu entdecken und die Korrespondenz zum eigenen Drama in den Versuchen, der Geschichte wenigstens einen Anfang zu geben, wenn doch ihr Ende schon bestimmt ist.
Was die Arbeit David Martons in Dresden zu Wagners „Das Rheingold“ betrifft, hat aber bereits eine neue Geschichte begonnen.
Boris Michael Gruhl lebt und arbeitet in Dresden als Autor, Kulturjournalist, Herausgeber und Redakteur. Dieser Text ist ein Originalbeitrag für das Spielzeitheft 2010.2011.
Zur Handlung
Erst nach einigen Jahren der Beschäftigung und schon tief im Stoff der Nibelungensage hat sich Richard Wagner dafür entschieden, seinem „Ring“ einen Vorabend voranzustellen: Ein Vorspiel, in dem er die Ursache des Zustandes der Welt untersucht, den Grund für ihre Erlösungsbedürftigkeit. „Das Rheingold“ ist ein Märchen- und Sagenstück vor aller Zeitrechnung, das aus dem nordischen Mythenschatz stammt, von Wagner aber verändert und überformt wurde. Dieses Vorspiel ist Grundlage für „Rheingold. Musiktheater nach Richard Wagner“: Wotan, oberster Gott, könnte heute mit Frau und Kindern in einer Art Großfamilie leben. Es ist eine Gruppe, die seltsame Ritaule pflegt und in einer besonderen Weise mit Musik umgeht – mit Wagners „Rheingold“. Gegenseitig erzählen sie sich vom Raub des Rheingoldes und von Alberichs Entsagung und Fluch, angeleitet von einem Dirigenten, der über allem wacht. In dieser Welt wird Wagners Geschichte um Liebe und Macht verhandelt.
Bei Wagner beginnt die Geschichte auf dem Grunde des Rheins: Die Rheintöchter lachen den hässlichen Zwerg Alberich aus, der die Mädchen zu erobern versucht. Weil von dem lüsternen Verliebten keine Gefahr zu drohen scheint, verraten die Rheintöchter ihm leichtsinnig ihr Geheimnis: Wer der Liebe entsagt, kann aus dem Rheingold einen Ring schmieden, der ihm die Macht über die Welt bringt. Doch der gekränkte Alberich leistet den Schwur, raubt den Rheintöchtern das Gold und wird Herrscher über das Volk der Nibelungen.
Zur gleichen Zeit ist bei den Göttern Walhall fertig gestellt worden, Wotans Burg, gebaut von den Riesen Fafner und Fasolt, die jetzt ihren Lohn fordern. Ausgemacht war Freia, die Göttin der Jugend. Doch diesen Vertrag kann Wotan nicht erfüllen, denn Freia sichert den Göttern Jugend und Unsterblichkeit. Endlich kommt Loge, der in dieser Frage Rat schaffen soll. Doch Loge hat nirgends auf der Welt etwas gefunden, was mehr bedeutet als Liebe – außer bei Alberich, der der Liebe abgeschworen hat und nun Macht und Reichtum besitzt. Die Riesen wollen auf Freia verzichten und fordern stattdessen Gold; und Wotan selbst will den Ring. Gemeinsam mit Loge steigt er hinab zu Alberich nach Nibelheim.
Dort hat die Herrschaft Alberichs bereits begonnen: Ein riesiger Hort liegt aufgehäuft, und immer mehr Gold schaffen die Nibelungen herbei. Auch der Tarnhelm, mit dem sein Träger unsichtbar wird, ist eben fertig geworden. Alberich erklärt den Göttern den Krieg: Er will die Macht über die Welt erlangen, die Götter entthronen und jedes Lebewesen zwingen, der Liebe zu entsagen. Doch Loge kann ihn überlisten: Stolz auf seine Macht lässt er sich hinreißen, sein Können vorzuführen. Er verwandelt sich erst in eine riesige Schlange, dann in eine Kröte – und wird von den Göttern gefangen.
Bei Wagner beginnt die Geschichte auf dem Grunde des Rheins: Die Rheintöchter lachen den hässlichen Zwerg Alberich aus, der die Mädchen zu erobern versucht. Weil von dem lüsternen Verliebten keine Gefahr zu drohen scheint, verraten die Rheintöchter ihm leichtsinnig ihr Geheimnis: Wer der Liebe entsagt, kann aus dem Rheingold einen Ring schmieden, der ihm die Macht über die Welt bringt. Doch der gekränkte Alberich leistet den Schwur, raubt den Rheintöchtern das Gold und wird Herrscher über das Volk der Nibelungen.
Zur gleichen Zeit ist bei den Göttern Walhall fertig gestellt worden, Wotans Burg, gebaut von den Riesen Fafner und Fasolt, die jetzt ihren Lohn fordern. Ausgemacht war Freia, die Göttin der Jugend. Doch diesen Vertrag kann Wotan nicht erfüllen, denn Freia sichert den Göttern Jugend und Unsterblichkeit. Endlich kommt Loge, der in dieser Frage Rat schaffen soll. Doch Loge hat nirgends auf der Welt etwas gefunden, was mehr bedeutet als Liebe – außer bei Alberich, der der Liebe abgeschworen hat und nun Macht und Reichtum besitzt. Die Riesen wollen auf Freia verzichten und fordern stattdessen Gold; und Wotan selbst will den Ring. Gemeinsam mit Loge steigt er hinab zu Alberich nach Nibelheim.
Dort hat die Herrschaft Alberichs bereits begonnen: Ein riesiger Hort liegt aufgehäuft, und immer mehr Gold schaffen die Nibelungen herbei. Auch der Tarnhelm, mit dem sein Träger unsichtbar wird, ist eben fertig geworden. Alberich erklärt den Göttern den Krieg: Er will die Macht über die Welt erlangen, die Götter entthronen und jedes Lebewesen zwingen, der Liebe zu entsagen. Doch Loge kann ihn überlisten: Stolz auf seine Macht lässt er sich hinreißen, sein Können vorzuführen. Er verwandelt sich erst in eine riesige Schlange, dann in eine Kröte – und wird von den Göttern gefangen.
Wieder in der Welt der Götter nimmt ihm Wotan das Gold ab und schließlich auch den Ring. Alberich verflucht diesen Ring: Jeder, der ihn besitzt, soll sterben. Um die Riesen zu bezahlen, müssen die Götter mit dem Gold nun Freia auslösen, wofür der ganze Hort inklusive Tarnhelm nötig ist. Schließlich fordern die Riesen auch den Ring, den Wotan aber auf keinen Fall hergeben will – bis Erda, die allwissende Urmutter der Erde, auftaucht und ihn vor den Folgen des Fluches warnt. Die Riesen erhalten den Ring und geraten bei der Aufteilung des Goldes sofort in Streit. Der Fluch zeigt seine Macht: Fafner erschlägt seinen Bruder Fasolt und geht alleine mit dem Gold davon, der Fluch mit ihm ...
Liebe, Entsagung, Fluch und Erlösung – Wagner spart nicht mit großen Begriffen in seinem Weltentwurf „Der Ring des Nibelungen“. Er selber lässt später als Erlöser Siegfried und Brünnhilde auftreten, die den Fluch zerschlagen, den Ring verbrennen und die Götter vernichten. Wagner hat gleichzeitig eine Sehnsucht nach Erlösung wie nach Ursprünglichkeit und Reinheit – auch des Mythos’, dessen ursprüngliche und reine Form er nicht im mittelhochdeutschen Epos findet, sondern zurückverfolgt bis in die nordische Sagenwelt. Er bewegt sich gleichzeitig zurück in eine mythische Vorzeit und vor in eine messianische Zukunft. Doch wenn man dem „Rheingold“ nicht den Rest des „Rings“ folgen lässt, bleibt man in der Welt des Fluchs gefangen und kann auf Erlösung nur hoffen. Die Ikonographie des Spirituellen und die Rituale, die unsere Gesellschaft dafür kennt, sind mannigfaltig und sowohl in der christlichen Tradition wie in fernöstlichen Lehren oder pseudoreligiösen Zusammenhängen zu finden.
„Rheingold“ ist „Musiktheater nach Richard Wagner“ im doppelten Sinn: Ein Theaterabend mit Musik, frei nach Wagners Oper, und gleichzeitig in der Nachfolge Richard Wagners. In diesem Sinne bewegt sich „Rheingold“ weit weg von Wagners Werk und sucht gleichzeitig eine enge Auseinandersetzung mit ihm.
Felicitas Zürcher
Liebe, Entsagung, Fluch und Erlösung – Wagner spart nicht mit großen Begriffen in seinem Weltentwurf „Der Ring des Nibelungen“. Er selber lässt später als Erlöser Siegfried und Brünnhilde auftreten, die den Fluch zerschlagen, den Ring verbrennen und die Götter vernichten. Wagner hat gleichzeitig eine Sehnsucht nach Erlösung wie nach Ursprünglichkeit und Reinheit – auch des Mythos’, dessen ursprüngliche und reine Form er nicht im mittelhochdeutschen Epos findet, sondern zurückverfolgt bis in die nordische Sagenwelt. Er bewegt sich gleichzeitig zurück in eine mythische Vorzeit und vor in eine messianische Zukunft. Doch wenn man dem „Rheingold“ nicht den Rest des „Rings“ folgen lässt, bleibt man in der Welt des Fluchs gefangen und kann auf Erlösung nur hoffen. Die Ikonographie des Spirituellen und die Rituale, die unsere Gesellschaft dafür kennt, sind mannigfaltig und sowohl in der christlichen Tradition wie in fernöstlichen Lehren oder pseudoreligiösen Zusammenhängen zu finden.
„Rheingold“ ist „Musiktheater nach Richard Wagner“ im doppelten Sinn: Ein Theaterabend mit Musik, frei nach Wagners Oper, und gleichzeitig in der Nachfolge Richard Wagners. In diesem Sinne bewegt sich „Rheingold“ weit weg von Wagners Werk und sucht gleichzeitig eine enge Auseinandersetzung mit ihm.
Felicitas Zürcher
Interview
Das künstlerische Team von „Rheingold. Musiktheater nach Richard Wagner“ über die Arbeit an Richard Wagner und seiner Musik, über Chorgesang, Urbanität, Sekten, Ideologie und Überwältigung: Regisseur David Marton, Pianist und Arrangeur Jan Czajkowski und Bühnen- und Kostümbildnerin Alissa Kolbusch. Das Gespräch führte die Dramaturgin Felicitas Zürcher.
Was hat Sie an der Oper „Rheingold“ gereizt? Warum inszenieren Sie diese Wagner-Oper, die eigentlich nur ein Vorspiel ist und gar kein eigenständiges Stück?
DAVID MARTON: Dass es ein „Vorabend“ ist, ist für mich fast das Spannendste an dem Projekt: Es gibt keinen dramatischen Konflikt im Stück; er entsteht erst. Wir beobachten die Entstehung eines Konflikts und nicht dessen Lösung. Außerdem gibt es eine Art Vorgängerprojekt: „Die Meistersinger“ von Wagner, inszeniert von Frank Castorf, bei dem Jan Czajkowski und ich beide beteiligt waren, und bei dem Christoph Homberger die musikalische Leitung hatte. Dabei haben wir uns das erste Mal gemeinsam mit Wagner beschäftigt.
Auf der Bühne sind Darsteller aus verschiedenen Bereichen versammelt – Schauspieler, Sänger und Musiker. Wie kommt diese Mischung zustande?
JAN CZAJKOWSKI: Was den Gesang angeht, haben wir Stimmen ausgewählt, die wir besonders mochten. Und zwar unabhängig von der Eignung zum üblichen Wagner-Gesang, dem oft die Anstrengung anzuhören ist, die mit der Bewältigung dieser Partien verbunden ist. Schon Wagner selbst hat das bedauert. Und insgesamt mussten wir darauf achten, dass wir ungefähr gleich viele hohe und tiefe, Frauen- und Männerstimmen haben, um für das Ensemble einen ausgewogenen Chorklang zu ermöglichen.
MARTON: Außerdem reflektiert das natürlich die klassische Opernsituation, in der es Sänger und ein Orchester gibt. Nur ist unser Orchester mit Jan Czajkowski und Martin Schütz ein extrem reduziertes. Auch bei den Darstellern hat die Zusammenstellung etwas mit Reduktion zu tun: Es geht, wie Jan Czajkowski eben sagte, nicht um Stimmvolumen, sondern um eine bestimmte Stimmfarbe. Daraus resultiert diese Mischung aus Schauspielern, klassischen Sängern bis hin zu der Jazz-Sängerin Yelena Kuljic. Es geht uns darum, der Wagner-Musik andere Farben abzugewinnen.
Was sind das für Farben? Und was ist die Lust daran, die Musik von Wagner anders zu interpretieren?
CZAJKOWSKI: Wir möchten die Aufführungen an den Opernhäusern ja nicht ersetzen. Aber wenn ich in der Partitur blättere, entdecke ich so viele Dinge, die man in der Oper nicht oder nur schwer wahrnehmen kann. Dann ist es doch schön, ein solches Detail einmal herauszunehmen und von verschiedenen Seiten zu betrachten. Das dreht sich dann minutenlang vor uns, während es im Original nur für ein paar Sekunden auftaucht. Oder wir kochen einen Abschnitt ein, auf eine Gesangslinie und ein harmonisches Gerüst etwa, und gewinnen dadurch eine klarere, schlichtere und durchsichtige Version. Überhaupt finde ich es reizvoll, Wagners Pathos einmal wegzunehmen und dann über die kammermusikalische Schönheit der Werke zu staunen. Manchmal bietet es sich natürlich auch an, das Pathos zu übertreiben, aber das ist bei uns eher die Ausnahme.
MARTON: Es gibt eine grundsätzliche Lust, Dinge anders zu betrachten und Neues zu entdecken. Deswegen machen wir einen Theaterabend und nicht die Oper. Unser Stoff ist das Stück mitsamt dem Komponisten und der Gefolgschaft, die ihn umgibt.
Wir treffen in dieser Inszenierung des „Rheingold“ nicht auf Riesen und Zwerge, sondern auf eine Gruppe, eine Art Sekte, die einen seltsamen Kult betreibt. Was ist das für eine Gruppe, und wie ist die Idee dafür entstanden?
MARTON: Es ist eine sehr rätselhafte Gruppe, die seltsame Dinge tut, die nicht zusammenpassen, aber alle rituellen Charakter haben. Die Hauptsache ist, dass es dieser Sekte um Musik geht, und zwar um die Musik von Richard Wagner. Über diesen Umweg landet man interessanterweise wieder bei der Realität: Es gibt tatsächlich Menschen, für die Wagner eine Art Lebenselixier ist, der wichtigste Bezugspunkt für das Leben und das Denken.
Und auch mit der Figur Wotan hat die Idee der Sekte zu tun: Er arbeitet an einer Idee, an einer Ideologie, an der Welterlösung – auch bei Wagner. Ausgehend von dieser Figur entstand dann auch seine Gefolgschaft.
CZAJKOWSKI: Ich denke, Wotan ist bei Wagner kein Gott im christlichen, auch nicht im antiken Sinn. Das Ende der Götter in der „Götterdämmerung“ gleicht wirklich erstaunlich dem Ende einer Sekte.
MARTON: Das sind die zentralen Fragen, die man sich auch in der Vorbereitung immer wieder stellt: Was sind die Götter, was sind die Riesen und die Zwerge? Für mich ist es spannender, einen modernen, städtischen Menschen zu zeigen, der eine Ideologie vertritt und sich anmaßt, anderen eine rettende Idee zu geben, sich selbst so etwas wie eine göttliche Kraft zuzusprechen.
Wie setzt sich diese Idee optisch in Raum und Kostüm um? Wie sehen moderne Riesen und Zwerge aus?
ALISSA KOLBUSCH: Dass diese Figuren moderne Menschen sein sollen, war von Anfang an klar. Mir war wichtig, dass man diese Attribute nicht äußerlich zeigt, sondern Charakterisierungen findet, die märchenhafte Elemente beschreiben könnten. Ob jemand naiv ist oder schön oder intellektuell, zeigt sich im Kostüm mehr durch dezente Details, die eine Figur charakterisieren, Aspekte einer Persönlichkeit hervorheben, statt durch Riesen-, Zwerge- und Nixen-Märchenkostüme. Diese Figuren sehen wir in einem Ausschnitt einer Großstadt. Mir war dabei vor allem die räumliche Enge wichtig. Das urbane Umfeld bewirkt eine Verdichtung von Emotionen und gesellschaftlichen Strukturen, die man dadurch komprimiert, wie durch eine Lupe vergrößert wahrnehmen kann. Städte sind der moderne Umschlagplatz für Werte, der Ort für Wertekonvertierung. In Städten wird Geld verdient und Geld ausgegeben – für Liebe, für Lust, für Unterhaltung. Und es ist der Ort, wo Macht ausgeübt wird. Machtzentren sind für mich nur in Städten vorstellbar, nicht in der freien Natur.
Wir sehen auf engstem Raum drei verschiedene Gebäude, keines davon ist intakt. Wie kommt es zu diesem Unfertigen?
KOLBUSCH: Die verfallene und unfertige Ästhetik finde ich elementar als Kontrast zur Opulenz der Wagner-Musik. Das zentrale Gebäude ist ein großbürgerliches Haus im Rohbau. Es ist zweistöckig, was zwingend ist, weil sich die Figuren im Stück ständig zwischen Ober- und Unterwelt bewegen. Zugleich wird so ermöglicht, die Handlung und Vorgänge auf der Bühne in einer Parallelität und in Überschneidungen zu zeigen – in verschiedenen Etagen oder in verschiedenen Räumen. Die internen Machtkämpfe und Intrigen werden durch die Parallelität der Orte deutlicher als Machtkämpfe eines Clans lesbar – moderne Dramen im urbanen Milieu, modellhaft ausgestellt.
Was hat Sie an der Oper „Rheingold“ gereizt? Warum inszenieren Sie diese Wagner-Oper, die eigentlich nur ein Vorspiel ist und gar kein eigenständiges Stück?
DAVID MARTON: Dass es ein „Vorabend“ ist, ist für mich fast das Spannendste an dem Projekt: Es gibt keinen dramatischen Konflikt im Stück; er entsteht erst. Wir beobachten die Entstehung eines Konflikts und nicht dessen Lösung. Außerdem gibt es eine Art Vorgängerprojekt: „Die Meistersinger“ von Wagner, inszeniert von Frank Castorf, bei dem Jan Czajkowski und ich beide beteiligt waren, und bei dem Christoph Homberger die musikalische Leitung hatte. Dabei haben wir uns das erste Mal gemeinsam mit Wagner beschäftigt.
Auf der Bühne sind Darsteller aus verschiedenen Bereichen versammelt – Schauspieler, Sänger und Musiker. Wie kommt diese Mischung zustande?
JAN CZAJKOWSKI: Was den Gesang angeht, haben wir Stimmen ausgewählt, die wir besonders mochten. Und zwar unabhängig von der Eignung zum üblichen Wagner-Gesang, dem oft die Anstrengung anzuhören ist, die mit der Bewältigung dieser Partien verbunden ist. Schon Wagner selbst hat das bedauert. Und insgesamt mussten wir darauf achten, dass wir ungefähr gleich viele hohe und tiefe, Frauen- und Männerstimmen haben, um für das Ensemble einen ausgewogenen Chorklang zu ermöglichen.
MARTON: Außerdem reflektiert das natürlich die klassische Opernsituation, in der es Sänger und ein Orchester gibt. Nur ist unser Orchester mit Jan Czajkowski und Martin Schütz ein extrem reduziertes. Auch bei den Darstellern hat die Zusammenstellung etwas mit Reduktion zu tun: Es geht, wie Jan Czajkowski eben sagte, nicht um Stimmvolumen, sondern um eine bestimmte Stimmfarbe. Daraus resultiert diese Mischung aus Schauspielern, klassischen Sängern bis hin zu der Jazz-Sängerin Yelena Kuljic. Es geht uns darum, der Wagner-Musik andere Farben abzugewinnen.
Was sind das für Farben? Und was ist die Lust daran, die Musik von Wagner anders zu interpretieren?
CZAJKOWSKI: Wir möchten die Aufführungen an den Opernhäusern ja nicht ersetzen. Aber wenn ich in der Partitur blättere, entdecke ich so viele Dinge, die man in der Oper nicht oder nur schwer wahrnehmen kann. Dann ist es doch schön, ein solches Detail einmal herauszunehmen und von verschiedenen Seiten zu betrachten. Das dreht sich dann minutenlang vor uns, während es im Original nur für ein paar Sekunden auftaucht. Oder wir kochen einen Abschnitt ein, auf eine Gesangslinie und ein harmonisches Gerüst etwa, und gewinnen dadurch eine klarere, schlichtere und durchsichtige Version. Überhaupt finde ich es reizvoll, Wagners Pathos einmal wegzunehmen und dann über die kammermusikalische Schönheit der Werke zu staunen. Manchmal bietet es sich natürlich auch an, das Pathos zu übertreiben, aber das ist bei uns eher die Ausnahme.
MARTON: Es gibt eine grundsätzliche Lust, Dinge anders zu betrachten und Neues zu entdecken. Deswegen machen wir einen Theaterabend und nicht die Oper. Unser Stoff ist das Stück mitsamt dem Komponisten und der Gefolgschaft, die ihn umgibt.
Wir treffen in dieser Inszenierung des „Rheingold“ nicht auf Riesen und Zwerge, sondern auf eine Gruppe, eine Art Sekte, die einen seltsamen Kult betreibt. Was ist das für eine Gruppe, und wie ist die Idee dafür entstanden?
MARTON: Es ist eine sehr rätselhafte Gruppe, die seltsame Dinge tut, die nicht zusammenpassen, aber alle rituellen Charakter haben. Die Hauptsache ist, dass es dieser Sekte um Musik geht, und zwar um die Musik von Richard Wagner. Über diesen Umweg landet man interessanterweise wieder bei der Realität: Es gibt tatsächlich Menschen, für die Wagner eine Art Lebenselixier ist, der wichtigste Bezugspunkt für das Leben und das Denken.
Und auch mit der Figur Wotan hat die Idee der Sekte zu tun: Er arbeitet an einer Idee, an einer Ideologie, an der Welterlösung – auch bei Wagner. Ausgehend von dieser Figur entstand dann auch seine Gefolgschaft.
CZAJKOWSKI: Ich denke, Wotan ist bei Wagner kein Gott im christlichen, auch nicht im antiken Sinn. Das Ende der Götter in der „Götterdämmerung“ gleicht wirklich erstaunlich dem Ende einer Sekte.
MARTON: Das sind die zentralen Fragen, die man sich auch in der Vorbereitung immer wieder stellt: Was sind die Götter, was sind die Riesen und die Zwerge? Für mich ist es spannender, einen modernen, städtischen Menschen zu zeigen, der eine Ideologie vertritt und sich anmaßt, anderen eine rettende Idee zu geben, sich selbst so etwas wie eine göttliche Kraft zuzusprechen.
Wie setzt sich diese Idee optisch in Raum und Kostüm um? Wie sehen moderne Riesen und Zwerge aus?
ALISSA KOLBUSCH: Dass diese Figuren moderne Menschen sein sollen, war von Anfang an klar. Mir war wichtig, dass man diese Attribute nicht äußerlich zeigt, sondern Charakterisierungen findet, die märchenhafte Elemente beschreiben könnten. Ob jemand naiv ist oder schön oder intellektuell, zeigt sich im Kostüm mehr durch dezente Details, die eine Figur charakterisieren, Aspekte einer Persönlichkeit hervorheben, statt durch Riesen-, Zwerge- und Nixen-Märchenkostüme. Diese Figuren sehen wir in einem Ausschnitt einer Großstadt. Mir war dabei vor allem die räumliche Enge wichtig. Das urbane Umfeld bewirkt eine Verdichtung von Emotionen und gesellschaftlichen Strukturen, die man dadurch komprimiert, wie durch eine Lupe vergrößert wahrnehmen kann. Städte sind der moderne Umschlagplatz für Werte, der Ort für Wertekonvertierung. In Städten wird Geld verdient und Geld ausgegeben – für Liebe, für Lust, für Unterhaltung. Und es ist der Ort, wo Macht ausgeübt wird. Machtzentren sind für mich nur in Städten vorstellbar, nicht in der freien Natur.
Wir sehen auf engstem Raum drei verschiedene Gebäude, keines davon ist intakt. Wie kommt es zu diesem Unfertigen?
KOLBUSCH: Die verfallene und unfertige Ästhetik finde ich elementar als Kontrast zur Opulenz der Wagner-Musik. Das zentrale Gebäude ist ein großbürgerliches Haus im Rohbau. Es ist zweistöckig, was zwingend ist, weil sich die Figuren im Stück ständig zwischen Ober- und Unterwelt bewegen. Zugleich wird so ermöglicht, die Handlung und Vorgänge auf der Bühne in einer Parallelität und in Überschneidungen zu zeigen – in verschiedenen Etagen oder in verschiedenen Räumen. Die internen Machtkämpfe und Intrigen werden durch die Parallelität der Orte deutlicher als Machtkämpfe eines Clans lesbar – moderne Dramen im urbanen Milieu, modellhaft ausgestellt.
Es gibt in der Produktion drei musikalische Leiter, die alle auch auf der Bühne stehen. Wie ist die Arbeitsteilung?
CZAJKOWSKI: Christoph Homberger ist selbst Sänger, bringt aber auch gerne andere zum Singen. Er hat ein fast magisches Talent darin, ein Ensemble so zum Klingen zu bringen, wie man es selbst von einem professionellen Chor nicht immer erwarten kann, und so unsere sehr vielgestaltige Gruppe hier zu einem wunderbaren Klangkörper zu vereinen. Darauf konnte ich bauen, als ich schon vor Monaten begann, Teile der Partitur in neue Arrangements zu bringen. Es gibt im „Rheingold“ ja eigentlich keinen Chor. So wurde aus einem originalen Bläsersatz mit Wagner-Tuben, Trompeten, Hörnern und Posaunen ein Chor für unsere Schauspieler, um nur ein Beispiel zu nennen. Auch wie ich selbst Wagners Musik am Klavier spiele, muss ich neu erfinden; ein Prozess, der jetzt, zwei Wochen vor der Premiere, noch anhält, da er auch mit der Inszenierung zusammenhängt. Martin Schütz schließlich ist ein experimenteller Musiker, der zwar aus der Klassik kommt, sich aber gerne sehr weit von ihr entfernt. Mithilfe seines „electric 5-string-cello“ und des Computers bereichert er uns mit einer ganzen Palette von Farben, oft an der Grenze von Musik und Geräusch. Seine Haltung der Musik gegenüber ist dabei sehr frei.
MARTON: Martin Schütz spielt meistens etwas Zusätzliches, was nichts mit der Partitur zu tun hat, er fügt der Musik ein Element hinzu, das bereichert oder sie auch konterkariert.
David Marton, auch Sie sind ursprünglich Musiker. Redet der Regisseur bei den musikalischen Fragen mit, und reden im Umkehrschluss die Musiker auch bei der Inszenierung mit?
CZAJKOWSKI: Das kommt tatsächlich beides recht häufig vor. Opernhäuser repräsentieren da eine völlig andere Welt: Dort leitet oft ein Dirigent eine Vorstellung, deren Regisseur er niemals kennengelernt hat. Bei uns sind die Behandlung der Musik und die Regie extrem eng miteinander verknüpft. Natürlich hat dennoch jeder seinen Bereich, aber wir müssen viel mehr Hand in Hand gehen, und wir müssen uns auch einmischen. David Marton mischt sich bei uns ein und wir uns bei ihm. Ich empfinde es aber als extreme Bereicherung, dass wir – aus vier recht unterschiedlichen Richtungen kommend – versuchen, gemeinsam einen Weg zu gehen.
MARTON: Dass es diese Gespräche gibt, ist schön und wichtig, und ich finde sie selbstverständlich. Für mich gibt es diese klare Grenze zwischen Regie und musikalischer Leitung überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass einem jemand reinquatscht, sondern tatsächlich um ein Mitdenken.
So arbeiten Sie auch mit den Darstellern. Auch diese sind beteiligt an dem Prozess der Entwicklung und der Erfindung des Abends.
MARTON: Ja, es ist wichtig, dass sich alle Beteiligten mit der Produktion identifizieren können. Die Darsteller stehen nach der Premiere auf der Bühne und müssen vertreten können, was man in den Wochen vorher gefunden, gedacht und entwickelt hat. Deswegen ist es wichtig, dass sie einbezogen sind.
Die berühmteste Stelle im „Rheingold“ ist vielleicht der knapp 140 Takte lange Es-Dur-Akkord, das Orchestervorspiel, mit dem Wagner einen Urton der Natur zeichnet. Was passiert mit dieser berühmten Stelle ohne Orchester?
CZAJKOWSKI: Das ist ein Paradebeispiel für die Versuche, die wir mit Christoph Homberger machen: Diese orchestralen Farben in Gesang umzumünzen. Die Passage bekommt dadurch etwas Meditatives.
MARTON: Die Inszenierung beginnt auch bei uns damit und zeigt im Prinzip das Credo der musikalischen Arrangements: Das Orchester ist auf der Bühne, und die Orchesterpassagen werden gesungen. Statt das Orchester-Vorspiel zu bebildern, wird so das Musizieren selber zum Thema auf der Bühne.
Die Musik in dieser „Rheingold“-Inszenierung ist komplett von Wagner, die Texte stammen aber bei weitem nicht alle aus „Rheingold“. Woher kommen sie, und warum diese Mischung?
MARTON: Es ist eher ein Nebeneinander als eine Mischung. Es gibt Stellen, wo man aus der „Rheingold“-Handlung kippt und in eine Parallelwelt schneidet. Wir verwenden lauter Texte, die in einem engen Bezug zu Wagner und speziell zu „Rheingold“ stehen. Hauptsächlich sind das Wagners theoretische Schriften, in zweiter Linie solche aus dem zeitlichen Umfeld und dem Bezugsraum von Wagner.
CZAJKOWSKI: Was die Musik angeht, so stammt sie zu einhundert Prozent von Wagner, zumindest als Grundlage. Sie klingt hier manchmal wie ein Klavierstück von Chopin, wie ein Standard im Jazzclub, wie ein Chor auf einem Horrorfilm-Soundtrack oder vieles andere, aber es handelt sich dabei immer um Gesangslinien, Instrumentalstimmen oder harmonische Abläufe aus der „Rheingold“-Partitur.
Wagner ist jemand, der immer schon extrem polarisierte – es gibt Fans und totale Gegner. Was haben Sie für ein grundsätzliches Verhältnis zu Wagner?
CZAJKOWSKI: Als ich elf war, sah ich im Fernsehen die berühmte „Ring“-Inszenierung von Patrice Chéreau und war extrem fasziniert. Daraufhin verschlang ich als Teenager alles, was ich von oder über Wagner bekam. Mein damaliger Klavierprofessor Paul Buck war sozusagen nebenbei Wagnerexperte, schrieb Bücher und hielt Vorträge, in denen er die musikalischen Strukturen sehr plastisch erklärte und vorführte. Inzwischen habe ich ein wenig Distanz aufgebaut, Wagner ist ja nicht nur ideologisch nicht unbedenklich, auch musikalisch ist nicht alles so umwerfend wie etwa „Tristan und Isolde“ oder die „Götterdämmerung“. Gerade was das „Rheingold“ betrifft, das ich als Ganzes immer noch sehr mag, wundere ich mich, wie ich manche Stellen früher so hingenommen habe, die mir jetzt recht ungeschickt vorkommen.
MARTON: Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Wagner, eine Ambivalenz zwischen Verführtsein und Ablehnung. Diese Ambivalenz fing irgendwann an, mich immer stärker zu faszinieren: Warum weiß ich nicht, ob ich Wagner liebe oder nicht? Allerdings galt meine Leidenschaft als Pianist immer mehr der Instrumental- und Kammermusik als den großen symphonischen Werken. Das ist auch der Hintergrund für meinen Umgang mit Opern. Der durchsichtige, polyphone Klang berührt mich einfach mehr. Die Verführung durch das Große ist mir immer suspekt. Außer man ist im Fußballstadion.
Die Überwältigung, die durch Wagners Musik geschehen kann, wird an diesem Abend nicht stattfinden?
MARTON: Es war eher die Aufgabe, dieser Überwältigung zu entgehen. Unser Experiment „Rheingold“ zielt eindeutig auf das Zarte. Mich interessierte die Frage, auch im Sinne einer eigenen Erfahrung, wie Wagner weit hinter seiner Lautstärke klingt – zum Beispiel, wenn man nur sein Echo hört und nicht die Klangquelle. Wenn man einer komplexen Sache ihre Qualität verweigert, werden plötzlich andere Dinge sichtbar. Und das kann interessant und überraschend sein.
CZAJKOWSKI: Christoph Homberger ist selbst Sänger, bringt aber auch gerne andere zum Singen. Er hat ein fast magisches Talent darin, ein Ensemble so zum Klingen zu bringen, wie man es selbst von einem professionellen Chor nicht immer erwarten kann, und so unsere sehr vielgestaltige Gruppe hier zu einem wunderbaren Klangkörper zu vereinen. Darauf konnte ich bauen, als ich schon vor Monaten begann, Teile der Partitur in neue Arrangements zu bringen. Es gibt im „Rheingold“ ja eigentlich keinen Chor. So wurde aus einem originalen Bläsersatz mit Wagner-Tuben, Trompeten, Hörnern und Posaunen ein Chor für unsere Schauspieler, um nur ein Beispiel zu nennen. Auch wie ich selbst Wagners Musik am Klavier spiele, muss ich neu erfinden; ein Prozess, der jetzt, zwei Wochen vor der Premiere, noch anhält, da er auch mit der Inszenierung zusammenhängt. Martin Schütz schließlich ist ein experimenteller Musiker, der zwar aus der Klassik kommt, sich aber gerne sehr weit von ihr entfernt. Mithilfe seines „electric 5-string-cello“ und des Computers bereichert er uns mit einer ganzen Palette von Farben, oft an der Grenze von Musik und Geräusch. Seine Haltung der Musik gegenüber ist dabei sehr frei.
MARTON: Martin Schütz spielt meistens etwas Zusätzliches, was nichts mit der Partitur zu tun hat, er fügt der Musik ein Element hinzu, das bereichert oder sie auch konterkariert.
David Marton, auch Sie sind ursprünglich Musiker. Redet der Regisseur bei den musikalischen Fragen mit, und reden im Umkehrschluss die Musiker auch bei der Inszenierung mit?
CZAJKOWSKI: Das kommt tatsächlich beides recht häufig vor. Opernhäuser repräsentieren da eine völlig andere Welt: Dort leitet oft ein Dirigent eine Vorstellung, deren Regisseur er niemals kennengelernt hat. Bei uns sind die Behandlung der Musik und die Regie extrem eng miteinander verknüpft. Natürlich hat dennoch jeder seinen Bereich, aber wir müssen viel mehr Hand in Hand gehen, und wir müssen uns auch einmischen. David Marton mischt sich bei uns ein und wir uns bei ihm. Ich empfinde es aber als extreme Bereicherung, dass wir – aus vier recht unterschiedlichen Richtungen kommend – versuchen, gemeinsam einen Weg zu gehen.
MARTON: Dass es diese Gespräche gibt, ist schön und wichtig, und ich finde sie selbstverständlich. Für mich gibt es diese klare Grenze zwischen Regie und musikalischer Leitung überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass einem jemand reinquatscht, sondern tatsächlich um ein Mitdenken.
So arbeiten Sie auch mit den Darstellern. Auch diese sind beteiligt an dem Prozess der Entwicklung und der Erfindung des Abends.
MARTON: Ja, es ist wichtig, dass sich alle Beteiligten mit der Produktion identifizieren können. Die Darsteller stehen nach der Premiere auf der Bühne und müssen vertreten können, was man in den Wochen vorher gefunden, gedacht und entwickelt hat. Deswegen ist es wichtig, dass sie einbezogen sind.
Die berühmteste Stelle im „Rheingold“ ist vielleicht der knapp 140 Takte lange Es-Dur-Akkord, das Orchestervorspiel, mit dem Wagner einen Urton der Natur zeichnet. Was passiert mit dieser berühmten Stelle ohne Orchester?
CZAJKOWSKI: Das ist ein Paradebeispiel für die Versuche, die wir mit Christoph Homberger machen: Diese orchestralen Farben in Gesang umzumünzen. Die Passage bekommt dadurch etwas Meditatives.
MARTON: Die Inszenierung beginnt auch bei uns damit und zeigt im Prinzip das Credo der musikalischen Arrangements: Das Orchester ist auf der Bühne, und die Orchesterpassagen werden gesungen. Statt das Orchester-Vorspiel zu bebildern, wird so das Musizieren selber zum Thema auf der Bühne.
Die Musik in dieser „Rheingold“-Inszenierung ist komplett von Wagner, die Texte stammen aber bei weitem nicht alle aus „Rheingold“. Woher kommen sie, und warum diese Mischung?
MARTON: Es ist eher ein Nebeneinander als eine Mischung. Es gibt Stellen, wo man aus der „Rheingold“-Handlung kippt und in eine Parallelwelt schneidet. Wir verwenden lauter Texte, die in einem engen Bezug zu Wagner und speziell zu „Rheingold“ stehen. Hauptsächlich sind das Wagners theoretische Schriften, in zweiter Linie solche aus dem zeitlichen Umfeld und dem Bezugsraum von Wagner.
CZAJKOWSKI: Was die Musik angeht, so stammt sie zu einhundert Prozent von Wagner, zumindest als Grundlage. Sie klingt hier manchmal wie ein Klavierstück von Chopin, wie ein Standard im Jazzclub, wie ein Chor auf einem Horrorfilm-Soundtrack oder vieles andere, aber es handelt sich dabei immer um Gesangslinien, Instrumentalstimmen oder harmonische Abläufe aus der „Rheingold“-Partitur.
Wagner ist jemand, der immer schon extrem polarisierte – es gibt Fans und totale Gegner. Was haben Sie für ein grundsätzliches Verhältnis zu Wagner?
CZAJKOWSKI: Als ich elf war, sah ich im Fernsehen die berühmte „Ring“-Inszenierung von Patrice Chéreau und war extrem fasziniert. Daraufhin verschlang ich als Teenager alles, was ich von oder über Wagner bekam. Mein damaliger Klavierprofessor Paul Buck war sozusagen nebenbei Wagnerexperte, schrieb Bücher und hielt Vorträge, in denen er die musikalischen Strukturen sehr plastisch erklärte und vorführte. Inzwischen habe ich ein wenig Distanz aufgebaut, Wagner ist ja nicht nur ideologisch nicht unbedenklich, auch musikalisch ist nicht alles so umwerfend wie etwa „Tristan und Isolde“ oder die „Götterdämmerung“. Gerade was das „Rheingold“ betrifft, das ich als Ganzes immer noch sehr mag, wundere ich mich, wie ich manche Stellen früher so hingenommen habe, die mir jetzt recht ungeschickt vorkommen.
MARTON: Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Wagner, eine Ambivalenz zwischen Verführtsein und Ablehnung. Diese Ambivalenz fing irgendwann an, mich immer stärker zu faszinieren: Warum weiß ich nicht, ob ich Wagner liebe oder nicht? Allerdings galt meine Leidenschaft als Pianist immer mehr der Instrumental- und Kammermusik als den großen symphonischen Werken. Das ist auch der Hintergrund für meinen Umgang mit Opern. Der durchsichtige, polyphone Klang berührt mich einfach mehr. Die Verführung durch das Große ist mir immer suspekt. Außer man ist im Fußballstadion.
Die Überwältigung, die durch Wagners Musik geschehen kann, wird an diesem Abend nicht stattfinden?
MARTON: Es war eher die Aufgabe, dieser Überwältigung zu entgehen. Unser Experiment „Rheingold“ zielt eindeutig auf das Zarte. Mich interessierte die Frage, auch im Sinne einer eigenen Erfahrung, wie Wagner weit hinter seiner Lautstärke klingt – zum Beispiel, wenn man nur sein Echo hört und nicht die Klangquelle. Wenn man einer komplexen Sache ihre Qualität verweigert, werden plötzlich andere Dinge sichtbar. Und das kann interessant und überraschend sein.
Partner
Eine Produktion des Staatsschauspiels Dresden und der Dresdner Musikfestspiele in Koproduktion mit den Wiener Festwochen und den Kunstfestspielen Herrenhausen