Wallenstein
Handlung
Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 war ein einschneidendes Ereignis der deutschen und europäischen Geschichte, das in seiner künstlerischen Aneignung Schiller wie auch später Bertolt Brecht zum Überarbeiten tradierter Kunstformen geführt hat. Schiller entwirft mit seinem Wallenstein das Porträt eines sich selbst ermächtigenden Herrschers, der einen Platz für sich in Europa beansprucht und sich damit gegen das überkommene Machtgefüge auflehnt. Der historische Wallenstein war einer der ersten modernen Kriegsunternehmer, bei ihm waren Feldzüge auch wirtschaftliche Unternehmungen. Im Krieg werden Grenzen neu gezogen, am Ende wird die Beute verteilt unter den Herrschenden, während ganze Bevölkerungen zu Nomaden werden, wenn sie nicht ermordet oder ausgehungert worden sind. Dreihundert Jahre nach der Schlacht am Weißen Berg bei Prag begann mit einem Attentat der Erste Weltkrieg, der nach nur kurzer Friedenszeit in den Zweiten Weltkrieg mündete – eine Geschichte von Völkermord und Zerstörung, die fast dreißig Jahre anhielt. Mit den von Schiller ‚erfundenen‘ Figuren Max Piccolomini und Wallensteins Tochter Thekla führte Schiller einen unbedingten Freiheitsbegriff und ein ethisches Korrektiv in die Handlung ein, so wie er sie in seinen theoretischen Schriften entworfen hatte. Doch welchen Bestand hat ein ‚kategorischer‘ ethischer Anspruch, wenn es im Krieg, damals wie heute, um die Ressourcen dieser Welt geht?
Erstmals inszeniert Regisseur Frank Castorf in Dresden und zeigt seine Lesart von Schillers Monumentaldrama und seine Reflexionen zur deutschen und europäischen Geschichte.
Eine Pause.
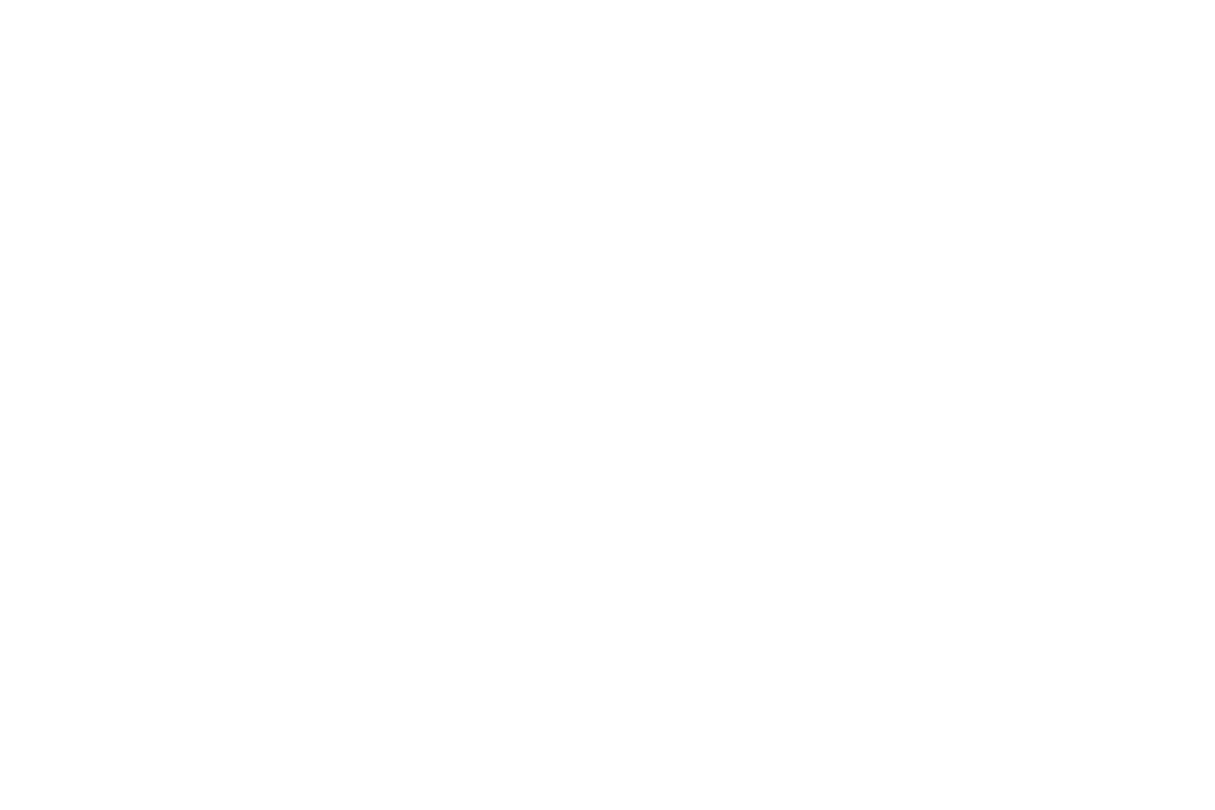
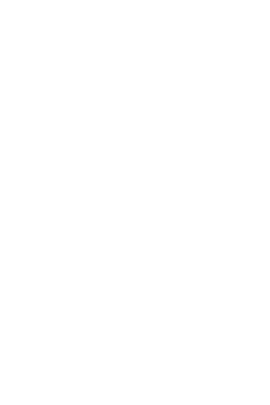
Ein Stück, wie geschaffen fürs nächste Berliner Theatertreffen.“